XVII.
Aufgrund der plötzlichen Wendung blieben Pesch, Marino und Delamotte noch eine weitere Nacht in Bergen. Unmittelbar nach Claudios Schüssen rief Malin einen Notarztwagen, während der aufgrund der Geräusche zurückgeeilte Pesch seinem norwegischen Kollegen Espensen Bescheid gab. Der norwegische Beamte, den der Uhu angeschossen hatte, überlebte trotz des erheblichen Blutverlustes. Osterfeld selber starb noch vor Ort.
Nach dem Abendessen machten die drei Marßener einen ausgedehnten Spaziergang am Hafen. Marino war die innere Belastung anzumerken, auch wenn Pesch und vor allem Delamotte versuchten, ihn zu beruhigen. „Sieh es einfach so, Claudio“, sagte Delamotte, „du hast heute drei Menschenleben gerettet. Eins davon war meines.“ Marino hatte dankbar genickt, aber es sollte noch ein paar Wochen dauern, bis er wieder ganz der Alte war.
Am Tag ihrer Rückkehr hielt die Polizei eine Pressekonferenz am Flughafen ab. Marino und Delamotte waren ganz dankbar dafür, dass Pesch diese Aufgabe bereitwillig übernahm, flankiert vom Polizeipräsidenten, dem Oberbürgermeister und dem Innenminister. Am Abend sahen die beiden Freunde immer wieder Ausschnitte davon auf den unterschiedlichsten Fernsehkanälen. Lissy hatte fränkische Rostbratwürste mit Sauerkraut und Kartoffelsalat zubereitet, Delamotte hatte passend dazu einen fränkischen Silvaner mitgebracht. Im Vergleich zu den Äußerungen der Politiker wirkte Pesch sehr seriös, auch wenn sein Verweis auf die exzellente Schießausbildung der Marßener Kripo bei Marino einen mittleren Lachanfall auslöste. Dennoch freuten sich beide über das Lob, das Delamottes überlegtem und gewagtem Hinhalten des Uhu, und Marinos schnellem und zielgerichtetem Handeln galt. Obschon sich Delamotte in den folgenden Tagen öfter die Frage stellte, warum zum Teufel Pesch so lange für die Bestätigung ihres Rückflugs gebraucht hatte. Aber diese Frage behielt er für sich.
Stattdessen fasste Delamotte den kompletten Werdegang Leo Osterfelds zum Uhu für einen Artikel in einer Fachzeitschrift zusammen. Pesch war von der Veröffentlichung so angetan, dass er allen Kollegen einen Scan des Artikels zumailte. Dabei mochte durchaus eine Rolle gespielt haben, dass Delamotte den Hauptkommissar mehrfach lobend erwähnte. Ein Umstand, der auch Michael Neumann nicht entging, der den Psychologen bei einer flüchtigen Begegnung auf dem Gang augenzwinkernd darauf ansprach. Ray Greene bat Delamotte im Chat um eine kurze Zusammenfassung des Falls, und machte den Uhu zum Thema eines Vortrags an der Akademie des FBI.
Bei einem ihrer vielen Gespräche fragte Delamotte seinen Kumpel Marino, was dieser mit dem Ausspruch gemeint hatte, mit dem er Osterfeld in Bergen zur Hölle geschickt hatte.
„Na, das ist doch wohl klar“, sagte Claudio, „natürlich war der Kerl ein Versager. Das hast du ja mehrfach beschrieben, und auch Pesch hat vor der Presse darauf hingewiesen, auch wenn die Burschen es nicht ganz verstanden haben.“
Delamotte sah nicht direkt, worauf Marino hinauswollte. „Schau mal“, erklärte der Kommissar, „dass du dich vor Malin gestellt hast, und dass du den Kerl aufgehalten und abgelenkt hast – das war unglaublich mutig von dir, und der Respekt aller Leute, die diese Geschichte kennen, ist dir sicher. Absolut verdient. Und zu den Leuten zähle auch ich.“
Delamotte spürte, dass da noch etwas nachkommen würde. „Aber wäre dieser Osterfeld nicht so ein Versager gewesen“, grinste Marino, „er hätte nach Betreten des Büros nicht einen Schuss abgegeben, sondern drei. Oder meinethalben vier, wenn man ihn auch noch mitzählt. Und Malin Gjelland läge jetzt auf einem Friedhof, und du wahrscheinlich immer noch in einem norwegischen Krankenhaus.“
Delamotte grinste nun ebenfalls, Marino traf den Nagel auf den Kopf. „Stattdessen hat der Kerl ein Gespräch mit dir begonnen“, sagte Claudio, „und erst das hat dir ja die Gelegenheit gegeben, ihn so lange hinzuhalten.“
„Das stimmt absolut, mein Freund“, sagte Delamotte, „der Typ war völlig darauf aus, meinen Respekt zu gewinnen.“
„Wundert dich das?“, fragte Marino. „Ab dem Moment, als du in den Fall eingestiegen bist, warst du ziemlich dicht an ihm dran. Und du bist immer näher gekommen. Bis in seinen Kopf. Sage übrigens nicht nur ich – sagt auch Jakob. Und das hat Osterfeld vielleicht nicht gewusst, aber er hat es gespürt.“ Delamotte hielt die Aussagen seines Kumpels für etwas weit hergeholt – aber er freute sich dennoch darüber.
Wobei sich ein unangenehmer Gedanke in seine Freude mischte. Was, wenn der nächste Killer, dem er gegenüberstand, nicht so ein Versager wie Osterfeld wäre? Oder waren grundsätzliche alle Verbrecher Versager? Delamotte blickte zurück, auf das was er gelernt, und das was er selber schon erlebt hatte. Und fast mochte es ihm so scheinen.
Das Schützenheim in Kessenich war brechend voll. Holger Baltes hatte der Familie Delamotte das Entrée bei der Kessenicher Schützengilde ermöglicht, und Delamottes Eltern hatten die überraschend geräumige Halle zu einem moderaten Preis anmieten können. Und an diesem Abend erschien es Markus Delamotte bisweilen so, als sei halb Bliesfeld vorbeigekommen, um Hildegard Delamottes 60. Geburtstag zu feiern.
Mit den Morenhovens verwandte Geschäftsleute waren ebenso erschienen wie Größen der Lokalpolitik, die der Familie spätestens seit den Zeiten von Onkel Jean verbunden waren. Auch Dechant Rademacher gratulierte, ebenso Pfarrer Weingarten von St. Clemens und Pfarrer Nowak von St. Barbara. Mutters wichtigster Gast war bereits am Vortag aus Berlin eingeflogen. Und falls Hardy Delamotte sich in seinem Geburtsort nicht wohlfühlte, dann verbarg er dies perfekt.
Etwa ein Monat war seit dem Ende des Uhu vergangen. Dennoch wurde Delamotte an diesem Abend immer wieder auf den Fall angesprochen. „Ein Bliesfelder Junge, und noch dazu einer von den Morenhovens“, sagte Onkel Philipp beim Versuch, Markus Delamotte den Arm um die Schultern zu legen. Da Markus seit der letzten Aktion dieser Art ganz offensichtlich erwachsen geworden, Onkel Philipp dagegen so klein und schmächtig wie immer geblieben war, blieb es bei einem Versuch.
Auch für Hildegard Delamotte schien der plötzliche Heldenstatus ihres jüngeren Sohnes wie ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Zumal die Heldentat nicht nur in den Zeitungen, sondern auch auf allen Fernsehkanälen verkündet worden war. Letzteres beeindruckte Opa Jacko kein bisschen: „Also das bedeutet ja gar nichts“, erklärte er, und reagierte auf Mutters entsetztes Gesicht mit einem Zwinkern in Richtung seines Enkels. „Fernsehen bedeutet nichts mehr, bei den vielen neuen Fernsehsendern. Ins Fernsehen kommt heutzutage jeder Blödmann“, sagte Opa Jacko. „Aber dass der Junge unbewaffnet diesen Mörder davon abgehalten hat, eine Frau zu erschießen – das war richtig groß.“ Er blickte Markus direkt an: „Und richte deinem Freund Marino meinen Dank aus, und den der ganzen Familie. Er hat einem Delamotte das Leben gerettet.“
Knapp eine Woche später stand Markus Delamotte in seiner Küche, eine große Tasse Milchkaffee in der Hand und sich allmählich verfestigende Pläne im Kopf. Er würde an diesem Freitag seinen Geburtstag nachfeiern. Und wenn ihn seine Erinnerung nicht trog, dann hatte er zuletzt bei seiner Abschiedsfete in Amerika eine derart große Zahl an Gästen bekocht. In den Tagen zuvor hatte er sich manchmal davor gefürchtet, mit dieser Aufgabe überfordert zu sein. Aber dann hatte ihm sein in jüngster Zeit gestiegenes Selbstbewusstsein geholfen.
Und er hatte ja auch Unterstützung. Bereits am Vortag hatte Hardy, der die ganze Woche in Marßen verbrachte, ihn zum Großeinkauf nach Belgien begleitet. Gemeinsam hatten sie die Einkäufe irgendwie verstaut bekommen, und sein großer Bruder hatte ihm einige zielführende Tipps für die grobe Planung des Freitags gegeben.
Am frühen Nachmittag würden Britta und Nicky vorbeikommen, um bei den Vorbereitungen für das Essen zu helfen. Delamotte wollte verschiedene Spezialitäten aus dem Land seiner Vorfahren zubereiten, und angesichts der Mengen konnte er jede Hilfe gebrauchen. Belgische Küche bedeutete natürlich unbedingt auch Fritten, und aus unerfindlichen Gründen war Kata in der Lage, eine ziemlich große Fritteuse zu besorgen. Am späteren Nachmittag würde seine Schwester mit dem Gerät eintreffen. Delamotte hatte eigens zum Aufstellen der Fritteuse, und um zusätzlichen Platz für die Unzahl an Zutaten zu schaffen, einen Tapeziertisch gekauft, der die der Kochzeile gegenüber liegende Längsseite der Küche einnahm. Den eigentlichen Küchentisch, neben der Arbeitsplatte ein weiterer Platz für Vorbereitungen, hatte er vor das Fenster gestellt. Delamotte blickte sich um. Ja, es würde eng werden.
In Gedanken teilte er den verfügbaren Platz auf dem Tapeziertisch ein. Einen recht großen Teil würden die Gemüse einnehmen: Chicorée, Sellerie, Möhren, eine Menge an Zwiebeln. Das Schneiden der Zwiebeln, dachte er, würde am besten auf dem Küchentisch vonstattengehen, bei geöffnetem Fenster. Er musste Platz einplanen für das dunkle Bier, das an die Lütticher Buletten, das Kaninchen mit Pflaumen und die flämische Karbonade gehörte. Und natürlich für den Weißwein, der die Muscheln in Sahne verfeinern würde. Daneben wäre noch genug Platz für Senf, Lütticher Sirup, Rosinen und ein paar andere Zutaten. Er öffnete den Kühlschrank. Noch war er gefüllt mit diversen Fleischsorten und Muscheln, Schinken und Speck, Butter, Schmalz und Milch. Und natürlich Rindernierenfett für die Fritten. Aber all das würde im Laufe des Nachmittags in Töpfen, Pfannen und auf Backblechen landen. Und dann wäre der Kühlschrank frei für jede Menge Bier. Delamotte blickte sich abermals um. Doch, das würde schon alles klappen.
Er ging rüber ins Wohnzimmer, das er am frühen Morgen bereits auf Vordermann gebracht hatte. Den großen Esstisch hatte er an die Wand gestellt – Töpfe, Pfannen, Backbleche und Schüsseln mit Fritten würden dort ohne Probleme ihren Platz finden. Er verteilte noch einige Untersetzer aus Kork auf dem Tisch. Fertig. Sitzgelegenheiten gab es genug, und Delamotte hatte sich im Vorfeld einige kleine Tischchen geborgt. Ja, dachte er, es würde alles klappen.
Er öffnete die drei Flaschen Palm und reichte je eine an Britta und Nicky weiter. Zum ersten Mal an diesem Nachmittag erlaubten sie sich eine Pause, bei der das eiskalte Amberbier äußerst gut tat. Delamotte hatte einen ganzen Berg Zwiebeln geschält und kleingehackt, während seine Nachbarinnen Möhren und Sellerie kleingeschnitten, Speck gewürfelt, Chicorée leicht gegart und mit Schinken umwickelt sowie Rindfleisch und Kaninchen in passende Stücke unterteilt hatten. Als nächsten Arbeitsschritt würde der Gastgeber aus Hackfleisch, Zwiebeln, Petersilie, Paniermehl und Ei die Buletten formen. Britta und Nicky würden die nächsten Vorbereitungen für Karbonade und Kaninchen übernehmen.
Es klingelte, das musste Kata sein. Delamotte hatte den Xsara bereits am Vormittag aus der Tiefgarage gefahren und einen Parkplatz auf der Straße gefunden. An der Gegensprechanlage bat er seine Schwester, auf ihn zu warten. Dann nahm er den Schlüssel und die Karte für die Tiefgarage und fuhr mit dem Lift nach unten. „Wir fahren in die Garage“, sagte er nach einer Umarmung, „mein Stellplatz ist frei, und von dort kommen wir bequemer mit der Fritteuse in meine Wohnung.“ Das Gerät lag auf dem Rücksitz von Katas Alfa, und es sah riesig aus. Einen Moment lang war Delamotte unsicher, ob dieses Monstrum nicht zu viel Platz auf dem Tapeziertisch einnehmen würde. Aber rasch setzte wieder der Optimismus ein, den er schon seit Monaten an sich bemerkt hatte, erst noch ganz schwach, dann stärker und seit dem Ende des Uhu fast schon überwältigend.
Als sie ihren Wagen geparkt hatte, fragte Kata: „Kann ich nachher bei dir noch duschen und mich umziehen?“
Er nickte: „Klar kannst du das.“
„Und was ist mit dir?“, wollte sie wissen.
Er lachte: „Ich habe heute Mittag geduscht, das muss reichen. Momentan würde es eh nichts bringen – ich werde ziemlich lange in der Küche stehen.“
„Du wirst dich aber hoffentlich nicht in der Küche verkriechen“, mahnte sie, „schließlich hast du Gäste, lieber Bruder.“
Er versprach Kata, diesen Aspekt des Abends nicht zu vernachlässigen.
Sie mussten zweimal fahren, um die Fritteuse und Katas Tüte mit ihrer Abendgarderobe nach oben zu bringen. Irgendwie schafften sie es auch, den gewaltigen Apparat so auf dem Tisch zu arrangieren, dass noch genug Platz für alles andere blieb. Seine Schwester kannte das Gerät bereits, alles rund um die Fritten war nun ihre Aufgabe. Er zeigte ihr, wo die großen Beutel original belgischer Fritten waren und wo das Fett zum Frittieren derselben. Dann nahm er sich eine große Schüssel und widmete sich den Lütticher Buletten.
Am späten Nachmittag verließen Britta und Nicky seine Wohnung, um sich frisch zu machen und umzuziehen. Aus der Küche zog bereits ein Duft wie bei Madame Severine durch die Wohnung. Die Buletten hatte er angebraten und eine Zeitlang im Ofen gebacken, nun köchelten sie in Biersauce auf kleiner Flamme vor sich hin. Das Kaninchen schmorte bei gleichfalls geringer Hitze in einer großen Pfanne, es fehlten nur noch die schon im Vorfeld angebratenen Zwiebeln und Speck sowie die Pflaumen.
Im Backofen schmorte schon seit einiger Zeit die Karbonade. Die mit Schinken umwickelten Chicons würden, übergossen mit der weißen Sauce zum Gratinieren, dem Rindfleischtopf später Gesellschaft leisten, wenn auch auf einer anderen Schiene.
Es blieben dann noch die Muscheln in Sahnesoße, die erst gegen Ende ganz frisch zubereitet würden. Auch an der Fritteuse war alles im Plan, Kata hatte die Fritten bereits ein erstes Mal vorfrittiert, das Fett hatte für den zweiten Gang die richtige Temperatur. Sobald die Gäste eintrafen, würde die erste Fuhre Fritten wieder im Fett landen.
Er reichte Kata eine Flasche Palm, öffnete sich selbst auch eine und ging mit ihr ins Arbeitszimmer. Die Assoziation des Geruchs aus der Küche mit Severines Lokal brachte Delamotte auf einen Gedanken. „Bist du immer noch Gelegenheitsraucherin?“, fragte er. Kata nickte: „Klar. Warum fragst du? Möchtest du eine?“ Er grinste und griff in eine der Schubladen seines Schreibtischs. Irgendwie hatte es ein Aschenbecher doch in einen der Umzugskartons geschafft, wie er am Vorabend bemerkt hatte. Kata ging ins Wohnzimmer und holte ihre Handtasche. Sie zog eine Schachtel Ducal und ein Feuerzeug aus der Tasche und reichte sie ihrem Bruder. Delamotte zündete sich eine Zigarette an und inhalierte – die erste seit zehn Monaten. Lange genug um zu verstehen, dass das Problem am Rauchen nicht in körperlicher Abhängigkeit bestand, sondern in regelmäßigen Gewohnheiten, die im Kopf eingebrannt waren. Und über seinen Kopf bestimmte doch letztlich er selber, verdammt noch mal.
Kata zog an ihrer Zigarette und blickte ihn an: „Wie viele Leute sind wir eigentlich heute Abend? Du hast ja genug Essen für mindestens zwei Dutzend Gäste vorbereitet.“
Er lächelte: „Na, das will ich doch hoffen. Den Gastgeber mitgezählt, sind wir gleich zweiundzwanzig.“
„Wow“, rief seine Schwester aus, „und wie viele davon kenne ich schon?“
Delamotte überlegte einen Augenblick: „Etwas über die Hälfte, würde ich sagen.“
„Spannend“, sagte Kata. Irgendwas war mit ihrem Bruder in den letzten Monaten passiert. Und das Ergebnis gefiel ihr.
Irgendwann im Laufe des Nachmittags war Markus einmal verschwunden, das erste Bier hatte sich bemerkbar gemacht. Kata hatte die Zeit für eine Plauderei unter Frauen mit Britta und Nicky genutzt. Sie hatten sich prima verstanden. Ihr schien, besonders Britta hatte Markus gegenüber einen ausgeprägten Beschützerinneninstinkt. So wie sie selber auch, war ihr eingefallen.
„Wenn du gleich duschen gehst“, hörte sie ihren Bruder sagen, „auf dem Waschbecken liegt ein frisches Badetuch.“ Kata nickte. Mit Markus war wirklich etwas passiert.
Die eintreffenden Gäste hörte Delamotte mehr, als dass er sie sah. Hin und wieder steckte jemand den Kopf durch die Küchentür. Einmal hörte er Kata begeistert kreischen; Augenblicke später erschien sie in der Küche und schalt ihn breit lächeln: „Du Schlingel, du hast vergessen mir zu sagen, dass Didier heute hier ist!“ Delamotte grinste. Nein, er hatte seiner Schwester ganz bewusst verschwiegen, dass Hardys Lebensgefährte noch am Donnerstag mit Air Marssen aus Berlin eingeflogen war.
Wenig später kamen Hardy und Didier selber in die Küche. „Falls ich richtig gezählt habe, sind wir vollzählig, kleiner Bruder.“
Hardy öffnete den Kühlschrank und nahm drei Flaschen Luxemburger Cremant heraus, Didier tat es ihm gleich. „Wie lange brauchst du noch?“, fragte Hardy.
„Bin fast fertig“, antwortete Delamotte und gab die angereicherte Sahnesoße zurück zu den Muscheln. „Fehlen nur noch die Fritten.“
Kurz nachdem im Wohnzimmer die Sektkorken geknallt hatten, kam Didier wieder in die Küche zurück. „Dein großer Bruder meint, du sollst eine Rede halten“, sagte der französische Journalist, der schon seit über zwei Jahren mit Hardy liiert war. „Ich kümmere mich um die Fritteuse. Vergiss nicht, ich stamme aus der Normandie, wir kennen uns auch ein bisschen mit Fritten aus.“
Markus Delamotte nickte und ersetzte das verschwitzte T-Shirt durch ein Sweatshirt, das er auf dem Fensterbrett bereitgelegt hatte. Die frische Luft von draußen hatte den Kampf mit den Düften der Küche verloren – das war aber immer noch besser als ein verschwitztes Shirt, dachte Delamotte. Rasch schaltete er noch den Ofen und die Herdplatten aus.
Im Wohnzimmer stellte er sich der Herausforderung, dass zwanzig Augenpaare auf ihn gerichtet waren. Hardy hatte ihm an der Tür ein volles Sektglas in die Hand gedrückt. „Mir wurde zugetragen, dass jemand nach einer Rede verlangt hat“, sagte Delamotte mit Blick auf seinen Bruder.
„Nicht jemand – wir alle verlangen danach“, hörte er Nicky rufen, die damit offenbar auf allgemeine Zustimmung stieß.
Direkt neben Hardy stand Kata, beide grinsten. „Nun gut“, sprach Delamotte weiter, „da sich mein großer Bruder gerade in meiner Nähe befindet, und meine toughe kleine Schwester auch, kann ich ja mal ein paar Worte riskieren.“
Er ließ seinen Blick über die Gäste schweifen. „Zunächst einmal bin ich froh, dass Ihr alle der Einladung gefolgt seid. Vielen Dank dafür. Es ist schön, dass Ihr hier seid.“
Kurz sammelte er den nächsten Gedanken. „Ihr wisst, dass mein Geburtstag schon ein paar Wochen zurückliegt. Und es ist auch bekannt, warum wir ihn mit Verspätung feiern.“ In diesem Moment galt seine Aufmerksamkeit ganz besonders denjenigen Gästen, die an der Ermittlung beteiligt gewesen waren. Er sah Claudio, Jutta und Niclas. Er sah Sabine Greven, Thomas Ludes und Hugo Alvarez, der hinter den beiden stand. „Zum Zeitpunkt meines Geburtstags hatten wir etwas Wichtigeres zu erledigen.“ Nach einer Kunstpause sprach er weiter: „Und wir haben es erledigt.“
Ein Lächeln erschien auf den Gesichtern vieler Gäste. Sabine warf ein: „Und sollte mir mal einer nach dem Leben trachten – ich hoffe, dann ist ein Delamotte in der Nähe.“
Zustimmendes Gelächter kam auf, aber Delamotte schüttelte lächelnd den Kopf: „Ein Delamotte alleine nutzt da gar nichts, Sabine. Da muss dann noch ein Marino dabei sein.“ Er zwinkerte seinem Kumpel zu. Claudio lachte, das Trauma von Bergen hatte er wohl endgültig überwunden.
„Und da ich gerade bei Claudio bin“, fuhr Delamotte fort, „er wird sich noch erinnern an einen Abend vor gut einem halben Jahr. Er und Lissy, Tatjana und Holger, Rebecca und Mischa, und natürlich Ali, der heute extra aus der Schweiz angereist ist.“ Er nickte seinem alten Freund zu: „Grüezi vielmals!“ Ali lachte und erhob sein Glas. „Das damals war meine Wohnungseinweihung“, erklärte Delamotte, „und wenn Ihr gerade nicht mitgezählt haben solltet: damals hatte ich sieben Gäste.“
Abermals überblickte er das fast schon überfüllte Wohnzimmer. „Heute seid Ihr einundzwanzig“, sagte er und klopfte auf seine Brust, „und das fühlt sich hier verdammt gut an.“ Fast so etwas wie Jubel kam auf. „Eigentlich ist es ja recht einfach“, fuhr Delamotte fort, „wir fühlen uns am besten, wenn wir Zeit mit Menschen verbringen können, die wir mögen. Je öfter wir das können, und je mehr Menschen daran teilhaben, desto besser.“
„Das ist etwas, das ich besonders in den letzten Monaten gelernt habe. Wieder gelernt, vermutlich“, sagte er. „Ich habe im abgelaufenen halben Jahr generell sehr vieles gelernt, und Ihr alle habt zu diesem Lernprozess beigetragen. Auch dafür gebührt Euch mein Dank.“ Er hob sein Glas: „Also trinken wir auf die guten Momente, und auf die Menschen, die wir mögen. Auf Euch!“ Ludes stimmte „For he’s a jolly good fellow“ an, die anderen fielen mit ein.
Danach musste Delamotte eine Runde durch das Wohnzimmer machen, jeder wollte einmal mit ihm anstoßen und ihn drücken. Henseler stellte ihm seine Freundin Romy vor, Sabine dankte ihm noch mal überschwänglich für die Einladung.
Hardy erklärte ihm mit breitem Grinsen: „Die meisten Abgeordneten müssten für so eine Rede einen teuren Schreiber engagieren.“
„Na, wenn ich mal eine berufliche Alternative suchen sollte, melde ich mich bei dir“, sagte der Gastgeber.
„Für den Job bist du, glaube ich, etwas zu ehrlich, kleiner Bruder“, antwortete Hardy.
Didier erschien in der Tür und gab ihm ein Zeichen. „So Leute“, rief Delamotte, „ich brauche ein paar kräftige Jungs, die beim Transport der Speisen helfen können.“ Theo, Erwin, Claudio und Hugo Alvarez folgten ihm in die Küche.
Er drückte jedem zwei Tücher in die Hand: „Damit Ihr Euch nicht die Finger verbrennt – kalt kochen kann ich nicht.“ Didier hatte bereits zwei große Schüsseln mit Fritten gefüllt, eine weitere Fuhre befand sich noch in der Fritteuse. Gemeinsam brachten sie die Töpfe, Pfannen, Schüsseln und Backbleche ins Wohnzimmer.
Als alle Speisen auf dem großen Tisch standen, erhob der Gastgeber noch einmal die Stimme: „Ich habe mich heute den Kochtraditionen der Heimat meiner Vorfahren verpflichtet gefühlt. Nun ja, eines Teils meiner Vorfahren.“ Er wies auf die verschiedenen Speisen: „Hier haben wir Lütticher Bouletten, Muscheln in Sahnesoße, Kaninchen mit Pflaumen, gratinierte Chicorées, und Flämische Karbonade. Dazu original belgische Fritten, natürlich in Rinderfett frittiert.“ Er blickte Marino an: „Zu Claudios großer Enttäuschung habe ich leider keinen Herver Käse bekommen.“
„Och wie schade“, rief Lissy, „auf den war ich besonders gespannt.“
„Was Getränke angeht“, fuhr Delamotte fort, „in drei der vier Ecken dieses Zimmers findet Ihr Alkoholfreies: Mineralwasser, Cola, Apfelschorle.“ Er zeigte in die vierte Ecke: „Eine Auswahl französischer Rotweine gibt es dort im Weinständer. Ein paar Flaschen Weißwein befinden sich im Kühlschrank. Dort gibt es auch eine bunte Auswahl belgischer Biere. Bedient Euch einfach.“ Delamotte blickte seine Gäste an: „Nun denn – das Büffet ist eröffnet.“
Irgendwann im Laufe des Abends sah Delamotte, wie Erwin zur Wohnungstür ging. „Bist du schon im Aufbruch?“, fragte der Gastgeber.
Erwin schüttelte den Kopf: „Nein, ich hole nur meine Gitarre rüber. Ich habe mich mit diesem Thomas unterhalten – er meint, wir könnten ein bisschen musizieren. Einen ersten schönen Song hat er schon vorgeschlagen. Und als er eben nach deiner Rede angefangen hat zu singen – na, ich muss schon sagen, der hat eine tolle Stimme.“
Delamotte wartete in der Tür, bis Erwin mit dem Instrument zurückkam. Ludes, Sabine, Britta und Lissy begrüßten ihn mit großer Freude. Erwin setzte sich auf seinen Stuhl und spielte ein paar Töne an. Thomas Ludes stand auf, und nach wenigen Augenblicken begann der junge Staatsanwalt zu singen: „In Dublin’s fair city where the girls are so pretty.” Delamotte erkannte das Lied, und er fiel mit ein. Beim Refrain sangen mehrere Leute mit, es klang ziemlich gut.
Nach „Molly Malone“ spielte Erwin einfach weiter, auch bei „Horch was kommt von draußen rein“ wurde fast so etwas wie ein Chorgesang daraus. Ein paar Lieder später hatte Claudio eine Idee. „Alter, du hast doch so ein Whiteboard“, sprach er Delamotte direkt an. „Lass uns das doch hier ins Wohnzimmer bringen und mindestens mal die Refrains darauf schreiben, damit jeder mitsingen kann. Es kennen ja nicht alle jedes Lied.“
Der Gastgeber ging rasch ins Arbeitszimmer und befreite das Whiteboard erst mal von vielen Post-its. Alte Überlegungen zum Uhu brauchte niemand mehr. Als er zurück ins Wohnzimmer kam, wandte er sich Marino zu: „Eines ist ja wohl klar, mein Freund. Du hattest die Idee, du darfst sie auch als Erster umsetzen.“
„Au ja“, sagte Britta, „als Italiener kannst du doch sicher ‚Volare‘ singen.“
„Ach Leute, bitte“, wehrte sich Claudio.
Delamotte grinste ihn an: „Versuch nicht uns zu erzählen, du könntest nicht singen. Vergiss nicht, mein Lieber, ich war schon mal in Italien. Im Dom von Mailand habe ich mal eine Messe besucht. Als die Gemeinde sang, klang es wie hier in Deutschland der Chor. Als der Chor sang, klang es wie Engel.“ Claudio lachte, seine italienische Seele fühlte sich gestreichelt.
„Also, der Italiener, der nicht singen kann, muss erst noch geboren werden“, ermunterte der Gastgeber seinen Kumpel. Der flüsterte kurz mit Erwin, beide lächelten und Claudio drehte das Whiteboard zur Seite, bevor er schrieb. Dann nickte er dem Gitarristen zu, die ersten Töne erklangen, und dann erklang Claudio Marinos Stimme: „Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente“. Die gefühlte Temperatur stieg, Delamotte fühlte sich wie auf der Stadtmauer von Lucca oder an einem kleinen Kanal in Venedig, vielleicht vor Zanipolo. Oder an einem Strand in Apulien oder Kalabrien. Pünktlich zum Refrain drehte Claudio das Whiteboard wieder um. „Lasciatemi cantare con la chitarra in mano“ sang die ganze Feiergesellschaft, und jeder fühlte sich für einen Augenblick wie ein wahrer Italiener.
„L’Italiano“ war definitiv der Beginn einer besonderen Nacht. Als Delamotte etwas später Biernachschub in den Kühlschrank brachte, hörte er ein Pärchen „Über den Wolken“ singen. Er tippte auf Jutta und Roland. Jemand kraulte ihn im Nacken. Er richtete sich auf. Vor ihm stand Tatjana, umarmte ihn und sagte: „Ich muss dich vorwarnen.“
„Wovor denn?“, fragte ein etwas verblüffter Psychologe.
Tatjana lächelte schelmisch: „Wenn das nächste Mal eine meiner Freundinnen einen Mann sucht – ich rede ausdrücklich nicht von Larissa – dann werde ich versuchen, Euch zu verkuppeln. Du bist sowas von Sowjet kompatibel!“
Delamotte lachte: „Was heißt das denn jetzt?“
„Kennst du diesen Spruch nicht?“, fragte Tatjana. „Du bekommst Leute wie mich aus der Sowjetunion, aber nicht die Sowjetunion aus Leuten wie mir.“
Erwin kam in die Küche. „Puh, ich brauche mal eine Pause und ein kaltes Bier“, erklärte er und öffnete den Kühlschrank.
„Wer spielt denn da gerade Gitarre“, fragte Delamotte, „ist das Thomas?“
„Nein, das ist Theo“, antwortete Erwin, „und er spielt richtig gut.“ Zwei Stimmen setzten ein, Nicky und Theo sangen auf Griechisch. Delamotte kannte das Lied nicht, aber es hörte sich sehr nach Mikis Theodorakis an.
Etwas später saß er mit Kata und Alvarez im Arbeitszimmer, er hatte sich von dem Ballistiker einen Zigarillo geschnorrt, dessen Geschmack sehr gut zu dem dunklen Leffe passte, das er dabei trank.
„Als wir zusammen in Holland waren“, sagte Hugo, „hast du bei mir einiges an Interesse geweckt, was die Geschichte dieser Gegend angeht.“
Delamotte erwähnte Bussmann: „Dieser Schulleiter muss seinen Schülern als Geschichtslehrer immer eine Sache mitgegeben haben: man findet hier überall Geschichte zum Anfassen.“ Aus dem Wohnzimmer klangen wieder italienische Töne herüber, Marino und einige andere Gäste sangen gemeinsam „Bella ciao“.
Zurück im Wohnzimmer, wollte sich Ali vom Gastgeber verabschieden. Er hatte nur einen ziemlich frühen Rückflug nach Zürich bekommen können.
„Aber erst musst du noch singen, vorher kommst du hier nicht raus“, schaltete Nicky sich ein.
Ali lächelte ein bisschen gequält, wechselte wenig später aber ein paar Worte mit Erwin. „La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs“ begann Ali, bevor Didier sich hinzugesellte und ein Duett entstand.
Danach begleitete Delamotte seinen alten Freund zu Tür. „Du musst bei Gelegenheit mal vorbeikommen“, sagte Ali, und korrigierte sich direkt: „Bei der nächsten Gelegenheit. Es ist sehr schön da, direkt am Neuenburger See.“
Die beiden umarmten sich, Delamotte versprach einen möglichst baldigen Besuch. „Pass auf dich auf, mein Freund“, sagte er.
„Du auch“, antwortete Ali, bevor er sich zum Gehen wandte. Delamotte blieb in der Tür stehen, bis Ali im Lift verschwunden war.
Die Stimmung im Wohnzimmer vertrieb sehr schnell die kurz aufgekommene Melancholie aus Delamottes Kopf. Holger und Tatjana gaben gerade „Kalinka“ zum Besten, wenig später sangen Thomas und Roland gemeinsam „Fields of Athenry“. Als Hardy schließlich mehrere Mitstreiter für „Wenn wir schreiten Seit an Seit“ fand, fühlte sich sein jüngerer Bruder wie damals als kleiner Junge, bei den Familienfeiern am Vossemer Wall.
Es war letztlich Britta, der irgendwann gegen halb vier etwas auffiel. „Markus hat noch gar kein Lied gesungen“, sagte sie.
Mehrere andere Gäste nickten, und Delamotte wurde klar, dass er um die Sache nicht herum kam. Er blickte zu Erwin: „Ich gehe mal davon aus, du kennst auf jeden Fall ‚Kein schöner Land‘.“
Sabine jedenfalls war begeistert: „Super! Das Lied habe ich ewig nicht mehr gehört, und noch länger nicht gesungen. Das machen wir!“ Hinter ihm schrieb Hardy schon den Text auf das Whiteboard.
Kurz darauf spielte Erwin die Melodie an, und Delamotte sang. Er sang beileibe nicht alleine.
„Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das uns're weit und breit wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit.“
Zu Beginn der zweiten Strophe musste er kurz zur Seite blicken, um sich verstohlen ein paar Tränen aus den Augenwinkeln zu wischen. Natürlich würde Deutschland nie mehr das schönste Land sein, wie es das in den unschuldigen Tagen seiner Kindheit gewesen war. Aber vielleicht, dachte Delamotte, wäre ja ein Kompromiss möglich. Vielleicht konnte sein Land zumindest ein schönes Land sein, unter all den anderen schönen Ländern. Er hatte zumindest noch Hoffnung.
„Nun Brüder eine gute Nacht, der Herr im hohen Himmel wacht, in seiner Güten uns zu behüten ist er bedacht.“
Delamotte nickte. Ja, so war es gut, so sollte es sein. Und er hatte noch Hoffnung. Der Reihe nach blickte er in die Gesichter seiner Gäste. Ja, er hatte auf jeden Fall noch Hoffnung.
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 31
-
Malins Wohnung lag in einem Apartmentblock am Stadtrand. Die Zufahrt zur Tiefgarage kontrollierten z…
-
22 Feb 2024
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 30
-
Auf dem Gang sprach Delamotte eine ihm entgegenkommende Krankenschwester an. „Entschuldigung, ich br…
-
22 Feb 2024
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
97 visits
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 32
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2025
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
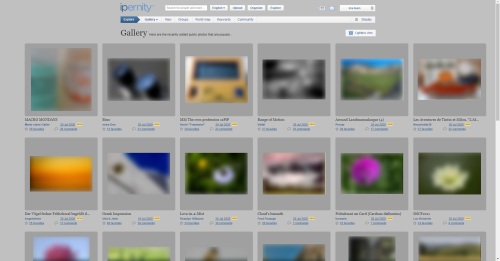
Sign-in to write a comment.