XIII.
„Tut mir leid, Markus, aber da bin ich skeptisch.“ Peschs Gesichtsausdruck untermalte das Gesagte sehr deutlich. Sie saßen zu dritt in Peschs Büro, Henseler hatte ihnen von seiner Recherche am Computer berichtet. Darin war er äußerst gut, fand Delamotte, und in diesem Punkt waren er und Pesch auch keinesfalls unterschiedlicher Meinung.
„In den letzten zehn Jahren sind genau 237 Personen bei Unfällen auf dem Marßener Ring getötet worden“, hatte Henseler seine Ausführungen eröffnet.
Pesch hatte überrascht reagiert: „Ich hätte eine höhere Zahl erwartet.“
„Die Autobahnen werden, was die Unfallhäufigkeit angeht, oft überschätzt“, hatte der junge Kommissar geantwortet. Marßen lag, was das Verhältnis dieser Opferzahl im Vergleich zur Bevölkerung anging, schon über dem Landesdurchschnitt. Das lag natürlich auch daran, hatte Henseler erklärt, dass die Stadt immer noch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt war, besonders den Autobahnring befuhren Verkehrsteilnehmer aus ganz Europa. „Nimm dann noch die ortsansässige Wirtschaft hinzu, und besonders in den milderen Monaten die Touristen. Da kommt einiges zusammen.“
Henseler hatte die Namen aller Unfallopfer in einer Tabelle erfasst, und einen Abgleich der Nachnamen mit denen der besonders guten Schützen vorgenommen. Bei Treffern hatte er versucht herauszufinden, ob sich irgendeine Art von Verwandtschaft zwischen den Personen herstellen ließ. Bislang jedoch erfolglos: „Es gab nur sechs Treffer – fünf davon waren sehr häufige Familiennamen, wie Müller oder Schmidt. Und auch beim sechsten Namen ließ sich keine Verwandtschaft feststellen.“
Delamotte hatte eingeworfen, dass enge Freunde und sogar Verwandte unterschiedliche Familiennamen haben konnten.
„Aber an die Namen von Verwandten der Opfer kommen wir nicht ran, von den Freunden ganz zu schweigen“, hatte Henseler gesagt.
Delamotte war darauf eingegangen und hatte einen Vorschlag in den Raum gestellt: „Traueranzeigen. Zumindest in den Fällen, die noch nicht so weit zurückliegen, sollte es Traueranzeigen doch auch in digitaler Form geben. Und wie du mir mal gezeigt hast: das Internet vergisst nichts. Und wenn jemand eine Traueranzeige aufgibt, kann man schon davon ausgehen, dass ihm die betrauerte Person sehr nahestand.“
Henseler war der Idee gegenüber nicht abgeneigt gewesen, aber Pesch hatte Einwände geäußert. „Bei allem Respekt, aber das ist mir zu aufwändig. Ihr müsstet erst mal nach Traueranzeigen suchen, sie eindeutig identifizieren, dann die Namen der Trauernden erfassen und das dann mit der Liste der Meisterschützen abgleichen. Das hört sich für mich nicht sonderlich effizient an.“ Delamotte und Henseler widersprachen, aber der Hauptkommissar ließ sich nicht überzeugen.
„Was schlägst du denn vor?“, fragte der Psychologe, ein bisschen in der Hoffnung Pesch auf dem falschen Fuß erwischen zu können.
„Teilt euch die Sache auf“, sagte Pesch. Henseler sollte sich die Schützen vornehmen. „Schau mal, welche digitalen Spuren die hinterlassen haben. Wenn du da irgendwas findest, sprich mich an, oder Manni. Dann müssen wir gezielter bohren.“ Dann blickte er Delamotte an: „Nimm du dir die Unfallakten vor – erst mal die aus den drei Jahren, bevor die Mordserie angefangen hat. Guck gezielt nach besonders schlimmen Fällen – besonders dann, wenn aus unserer Sicht die Schuldfrage ziemlich eindeutig geklärt ist.“
Als Delamotte mit einem Haufen Akten, von Henseler gescannt und auf CDs gebrannt, das Präsidium verließ, fürchtete er sich ein Stück weit vor dieser Lektüre. In den Unterlagen befand sich eine Menge menschlichen Leids. Andererseits dachte er, die neue Aufgabe könnte ihn vielleicht von dem Gefühl ablenken, das er seit dem Spaziergang im Park zu verdrängen suchte.
In einer kleinen Schüssel mischte Delamotte gehacktes rohes Gemüse mit Würfeln von Schafskäse und gab Olivenöl und Essig hinzu. Mehr als einen Salat konnte er an diesem Abend nicht essen, und das lag nicht nur an den Unfällen, deren Akten er über den Tag verteilt studiert hatte. Immer wieder hatte er diese undankbare Arbeit unterbrechen müssen, und sich so manches Mal nach einer Zigarette gesehnt.
In den drei Jahren vor dem ersten Mord des Uhu waren auf dem Marßener Ring 65 Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen. Relativ rasch hatte er die Fälle aussortiert, bei denen Fahrer ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatten. Das war allerdings nur ein kleiner Teil der Fälle gewesen. Delamotte hatte überrascht, wie oft das Versagen eines Menschen das Leben von Anderen beendet hatte.
Einige der Akten waren verdammt harte Lektüre gewesen. Junge Leute, die das ganze Leben noch vor sich gehabt hatten, befanden sich unter den Opfern ebenso wie solche, die nach einem langen Arbeitsleben einem ruhigen Dasein als Rentner entgegengeblickt hatten, ohne es jemals zu erreichen. Delamotte war mit dem Tod eines angesehenen Mannes konfrontiert worden, Zeit seines Lebens ein hilfsbereiter Mensch – das Wort Wohltäter schien in diesem Fall mehr als angebracht. Der Mann war in seinem Auto verbrannt, nur aufgrund der Unachtsamkeit eines anderen Fahrers. Eine andere Akte hatte den fremdverschuldeten Unfalltod einer Mutter und zweier ihrer Kinder beschrieben – und Delamotte die Frage gestellt, wie der Ehemann und Vater sowie ein älteres Kind mit diesem Verlust umgehen sollten. Es war eine Frage, der er sich gar nicht stellen wollte.
Immer wieder war ihm im Laufe des Tages der Gedanke gekommen, dass all diese Schicksale den Glauben erschüttern konnten. Wenn er selber als Hinterbliebener mit einem solchen Unglück konfrontiert wäre – würde er dann nicht einige Überzeugungen, ja sogar Sicherheiten infrage stellen müssen? Würde er sich nicht fragen, wie Gott derartiges zulassen konnte? Selbst wenn er wusste, dass es eben nicht Gott war, der es zuließ – Menschen ließen es zu, und das war nicht weniger ernüchternd.
Eines der vielen Unfallopfer, deren Schicksal Delamottes Weg an diesem Tag kreuzte, war ein Mann gewesen, dessen Leben alles andere als vorbildlich gewesen war. Getötet am selben Tag und vermutlich nur wenige Meter entfernt von Brückners Tochter. War das Schicksal dieses Mannes weniger bedauernswert als das des Wohltäters, der Mutter und ihrer Kinder, der Tochter des Stasimannes? Hatten nicht vielleicht auch um ihn Menschen geweint? Delamotte war sich fast sicher. Absolut sicher war er, dass keine dieser Akten irgendeinen Hinweis auf den Uhu enthielt.
Du steckst nirgendwo in diesen Akten. Ich glaube fast, einen solchen Verlust hast du nie erlitten. Der Verlust einer geliebten Person lässt die meisten Menschen innehalten. Innehalten. Ich glaube, du verstehst nicht einmal die Bedeutung dieses Wortes. Dafür ziehst du zu viel Befriedigung aus dem, was du tust.
Die Sache mit Brückner hätte dir doch die Gelegenheit gegeben, innezuhalten. Ich rede nicht mal vom Aufhören. Nur vom Innehalten. Aber genau das konntest du nicht. Du wolltest es nicht. Du hast den Mord an der Krankenschwester inszeniert. Es hat dir nicht einmal gereicht, einen weiteren Mord mit der gleichen Waffe zu begehen. Das hätte ja schon genügt, uns klarzumachen dass es dich noch gibt. Aber du musstest gleich noch ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Hat es dich so getroffen, dass man dich für tot hielt?
Er stellte die Schüssel in den Kühlschrank. Nur ein paar Gabeln von dem Salat hatte er gegessen, eher lustlos in seinem Abendessen herum gepickt – und das hatte nichts mit dem Geschmack des Salats zu tun.
Delamotte nahm die Flasche La Clape, die er vor gut einer Stunde entkorkt hatte, und goss sich ein Glas ein. Er hatte gerade im Sessel Platz genommen, als sein Handy sich meldete. Die Nummer im Display war ihm nicht bekannt, einen Moment lang überlegte er, den Anruf zu ignorieren. Dann nahm er ihn doch an, hörte eine vertraute Stimme: „Hallo, Theo hier. Kannst du bitte mal zu uns kommen?“ Ein wenig überrumpelt, sagte er zu. Als Delamotte sich die Schuhe anzog, dachte er über den Anruf nach. Er hatte nicht wie eine Einladung geklungen, sondern eher wie ein Marschbefehl. Mit einem Schulterzucken griff er sich den Wohnungsschlüssel und machte sich auf den Weg.
Im Lift kam ihm der Gedanke, wer wohl noch bei Nicky und Theo sein könnte. Britta vielleicht? Und falls ja: womöglich in Begleitung des Mannes aus dem Park? Würde sie ihm das antun? Wusste sie überhaupt, wie sehr er sie mochte? Wirklich gesagt hatte er ihr das nie – er war schon immer etwas unbeholfen in derartigen Dingen gewesen, und das Stück Selbstsicherheit, das er in Amerika gewonnen hatte, war in den Jahren mit Sonja komplett weggeschmolzen.
Als er im zweiten Stock ankam, fühlte er sich schwach, ihm war flau im Magen. Gegebenenfalls hätte er doch etwas mehr essen sollen. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, die Einladung abzulehnen. Oder den Marschbefehl zu verweigern, je nachdem wie man es sah. Stattdessen betätigte er die Klingel.
Nicky öffnete die Tür mit einem Lächeln, umarmte Delamotte und führte ihn ins Wohnzimmer. Theo goss ihm gerade ein Glas Rotwein ein, auf dem Couchtisch stand eine Platte mit griechischen Spezialitäten. „Setz dich doch“, sagte Theo, „greif zu.“
Delamotte nahm Platz, trank einen Schluck Wein und füllte den Teller, der vor ihm stand, mit frittierten Fischen, zwei Auberginenscheiben und einem Löffel weißer Bohnen. Schon der Anblick und der Duft des Essens beruhigte seinen Magen etwas – auch der Umstand, dass außer den Gastgebern niemand zugegen war, mochte dazu beitragen.
„Wie geht es dir?“, fragte Nicky.
„Müde und überspannt“, antwortete er, „ihr habt es ja sicher mitbekommen, der Fall ist noch nicht gelöst. Irgendwo da draußen läuft ein Mörder rum.“
Nicky und Theo blickten sich an. „Ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, warum du so schlecht aussiehst“, sagte sie zu Delamotte.
Theo ergänzte: „Britta war gestern hier. Ich war noch nicht zuhause, sie hat mit Nicky gesprochen.“
Seine Partnerin übernahm wieder: „Sie hat dich kürzlich im Park gesehen. Und du hast sie gesehen, das sehe ich dir an.“ Delamotte musste schlucken. „Und ja, sie war nicht alleine“, fuhr sie fort, „und auch wenn das für dich ein schwacher Trost ist: du bist nicht der einzige, dem es wegen dieser Begegnung gerade schlecht geht.“
Theo reichte dem Gast ein reichlich gefülltes Glas Tsikoudia: „Komm, runter damit, das wird dir gut tun.“ Damit hatte er ganz recht, wie Delamotte schnell merkte.
Nicky trank einen Schluck Wein, bevor sie weitersprach: „Britta sah furchtbar aus, als sie gestern hier klingelte. Mindestens so schlimm wie du, Markus. Sie wusste, dass so ein Moment mal kommen würde. Sie wusste, dass sie dir wehtun würde. Auch wenn sie das überhaupt nicht wollte.“ Nicky schaute ihn an: „Sie hat da gesessen und geheult. Von daher: wenn du willst, lass deine Tränen ruhig raus.“
Theo legte ihm die Hand auf die Schulter, aber Delamotte schüttelte den Kopf: „Ich hatte keine Ahnung, dass sie wusste…“
„Was“, fragte Nicky, „dass du viel für sie empfindest? Natürlich wusste sie das. Das war doch nicht zu übersehen.“
„Wir beide haben es doch auch direkt gemerkt“, warf Theo ein, „schon an dem Abend bei Britta, als wir dich kennengelernt haben. Hast du denn umgekehrt nicht gemerkt, dass sie dich sehr mag? Du bist doch Psychologe.“
„Jetzt redest du Unsinn, Schatz“, kritisierte Nicky ihn, „Psychologe oder nicht – Markus ist erst mal ein Mann, genau wie du. Du bekommst viele Sachen auch nicht mit, wenn es um Gefühle geht.“
Sie ergriff Delamottes Hände. „Du musst wissen, Markus“, sagte sie, „dass Britta dich mag. Das ist das eine.“ Sie überlegte eine Weile. „Das andere ist, dass Britta viel weiter ist als du. Ihre Trennung ist abgeschlossen. Da ist nichts mehr, das sie hält. Du dagegen…“
„Du brauchst mir das nicht zu erklären“, unterbrach er sie sanft, „ich weiß das ganz genau. Momentan könnte ich gar keine Beziehung eingehen – alles, was eine Frau an mir hätte, wäre ein verwundetes Herz, das Pflege braucht. Das kann ich von niemandem erwarten – am allerwenigsten von Britta.“
Nicky kam näher und drückte ihn. Seine Augen wurden feucht, aber er fühlte auch so etwas wie Erleichterung.
Im Laufe des Abends, während sie peu a peu zu leichteren Themen übergingen, wurde Delamotte die wahre Bedeutung seiner Freundschaft mit Britta immer deutlicher. Wenn es so etwas wie ein Schicksal gab, das ihre Wege zusammengeführt hatte, dann war dies aus einem Grund geschehen. Es machte ihm klar, wie toxisch seine Beziehung mit Sonja gewesen war – und dass es für ihn keinen Grund gab, das Ende dieser Beziehung zu betrauern.
Und als er, viel später, in seine Wohnung zurück kam, überraschte ihn sein wieder erweckter Appetit. Der Salat, den er so achtlos in den Kühlschrank verbannt hatte, überstand die Nacht jedenfalls nicht. Dass er dieses Los mit dem La Clape teilte, obschon der Wein inzwischen ein wenig zu warm geworden war, verbuchte Delamotte unter familiären Traditionen.
Am frühen Samstagnachmittag klingelte Britta Kowallik bei Markus Delamotte. Er wirkte nicht unbedingt überrascht. Britta folgte ihm ins Wohnzimmer, für eine gewisse Zeit – die beiden unendlich lang vorkam – saßen sie schweigend beisammen.
„Markus, ich… Es tut mir leid, dass das so…“, begann sie, sehr unsicher.
„Es muss dir nicht leidtun“, sagte er. „Streng genommen darf es dir nicht mal leidtun“, verschärfte er seine Aussage noch.
Britta widersprach ihm kopfschüttelnd: „Ob ich das darf oder nicht, spielt doch keine Rolle. Ich weiß, worauf du hinauswillst. Wir sind kein Paar, sind nie eins gewesen. Richtig. Und doch auch falsch.“ Sie beugte sich vor, nahm sein Gesicht zwischen ihre Hände. „Ich weiß, dass ich dich verletze, ohne es zu wollen“, flüsterte sie. Ein paar Tränen rollten über ihr Gesicht.
Markus Delamotte hatte selber zu kämpfen, aber erlauben wollte er sich die Tränen nicht – nicht jetzt, nicht in diesem Moment. Später vielleicht. Sanft nahm er Brittas Hände aus seinem Gesicht, berührte sie sachte mit seinen Lippen, ein Hauch, eine Andeutung nur. Er stand auf, zog Britta zu sich hoch und schloss seine Nachbarin in die Arme.
„Und doch gibt es Umstände, an denen wir beide nichts ändern können, auch wenn wir es wollten“, sprach er leise. Sie blickte ihm in die Augen, beruhigte sich etwas. „Wichtig ist“, hörte sie seine Stimme, „dass wir Dinge, die wir beeinflussen können, nur dann ändern, wenn wir es wirklich wollen.“
Sie nickte: „Ich wünsche mir so sehr, dass sich zwischen uns nichts ändert. Zumindest nichts, dass sich nicht ändern muss.“
„Das wird es auch nicht“, sagte er und lächelte. Britta ahnte, dass ihr Nachbar zumindest ein bisschen flunkerte – aber das war ihr ganz recht und übelnehmen konnte sie es ihm schon gar nicht.
Sie wandte sich zum Gehen. Kurz vor der Wohnungstür ergriff sie noch einmal seine Hände. „Ich habe nicht wirklich viele Freunde, Markus“, sagte sie stockend. „Meine alten Freunde in Frankfurt werden sich kaum noch an mich erinnern, und hier bin ich gerade erst dabei, mir ein Netzwerk aufzubauen.“ Sie zog ihn an sich. „Von den Freunden, die ich habe, bist du mir der wichtigste“, erklärte sie. Dann küsste sie ihn sanft und öffnete die Tür.
Delamottes Blick folgte Britta, als sie den Korridor hinunter Richtung Aufzug ging. Abermals wurde ihm klar, wie schön sie war. Doch sein Blick war nicht der eines Mannes, sondern der eines Freundes.
Es brodelte in Delamotte. Es brodelte gewaltig. Er hatte die Sache von Marino erfahren, Lüttges hatte sie bestätigt. Immer noch auf ein Missverständnis hoffend, stürmte Delamotte durch die Gänge des dritten Stocks, bis er vor Peschs Büro stand. Die Tür war zu, er klopfte kurz an und wartete nicht auf eine Antwort. Hans-Jakob Pesch, den Telefonhörer in der rechten Hand, sah erstaunt aus, winkte den Psychologen aber hinein. „Gut, ich bin in einer halben Stunde bei dir“, sagte er und legte auf.
„Das kann nicht dein Ernst sein“, sagte Delamotte, „oder ich habe da irgendwas falsch verstanden?“
„Ich weiß gar nicht, was du hast“, antwortete Pesch, „die Idee stammte doch von dir.“
„Wie meinst du das denn jetzt?“, fragte Delamotte und geriet immer mehr in Rage.
Pesch blieb ganz ruhig: „Na, du hast doch erkannt, dass der Uhu es eigentlich auf diese andere Krankenschwester abgesehen hatte, diese Sabrina.“ Den Umstand konnte der Psychologe nicht bestreiten. „Beide blond, ähnliche Größe, ähnliche Statur“, zählte Pesch die Punkte auf, die Delamotte längst bekannt waren, „und Monika Zerres hat das Auto von dieser Sabrina übernommen, als sie Anfang des Jahres in der Firma angefangen hat. Und diese Sabrina war als ziemliche Raserin bekannt, während die Zerres eine ganz vorsichtige Fahrerin war. Passt doch alles.“
„Natürlich passt es“, rief Delamotte aus, „aber das ist doch kein Grund, Sabrina Rosen dem Uhu jetzt als Köder zu präsentieren.“
„Nun mach bitte mal einen Punkt“, erwiderte Pesch, nun ebenfalls lauter.
Delamotte schüttelte unwillig den Kopf. Wie sonst sollte man denn beschreiben, was Hauptkommissar Hans-Jakob Pesch gerade tat? Er würde den Medien gegenüber andeuten, dass dem Uhu bei seinem jüngsten Opfer eine Verwechslung unterlaufen war. Dass dieser Fehler das Leben eines unschuldigen jungen Menschen gekostet hatte. Dass die Person, der all das eigentlich gegolten hatte, völlig entnervt sei, krankgeschrieben, zuhause. In der Erwartung, dass der Uhu herausfinden würde, wo sich Sabrina Rosens Zuhause befand. In der Annahme, dass man sie zuhause besser beschützen konnte als unterwegs bei der Berufsausübung. In der Hoffnung, der Uhu würde versuchen, seinen tödlichen Fehler dadurch zu korrigieren, dass er daranging, die Person zu erwischen, der sein Plan gegolten hatte.
„Das mit dem Köder nehme ich dir ernstlich übel“, sagte Pesch, „wir werden alles tun, um die junge Frau nicht zu gefährden. Rund um das Haus, in dem sie wohnt, werden mehrere Teams die Umgebung im Blick haben. Es werden immer drei Personenschützer in ihrer unmittelbaren Nähe sein. Und im Vorfeld haben wir bereits abgeklärt, welche Personen mit einer gewissen Regelmäßigkeit das Haus betreten. Nicht nur die Mieter, sondern auch Handwerker, Reinigungskräfte, sogar die Post und die großen Paketdienste sind involviert. Wenn sich dort jemand anderes dem Haus nähert, haben wir alles im Griff. Und wenn das Ganze nach Einbruch der Dunkelheit passiert…“ Der Hauptkommissar machte ein Geräusch, das wohl das Klicken von Handschellen andeuten sollte.
Delamotte glaubte seinen Ohren nicht. „Und wie lange willst du dieses Spiel durchhalten? Ein paar Tage? Eine Woche? Zwei Wochen? Einen Monat? Was, wenn bis dahin nichts passiert ist? Bläst du die Sache dann ab?“ Er beugte sich vor. „Und was, wenn der Kerl dann erst zuschlägt? Genau dann, wenn Sabrina Rosen im Gefühl der Sicherheit wieder ihrem Beruf nachgeht? Genau dann, wenn keine Personenschützer mehr bei ihr sind?“
Pesch hob die Hände: „Markus, dieser Gedanke ist nun wirklich ein bisschen…“
„Was ist er“, unterbrach ihn Delamotte ziemlich grob, „weit hergeholt? Zu pessimistisch? Jakob, wir sind nun seit gut einem Jahr hinter diesem Typen her. Und ich gebe zu, wir wissen nicht, wer er ist und wo er ist. Wir wissen nicht mal genau, was er ist.“ Er holte tief Luft: „Aber wir wissen sehr genau, was er nicht ist. Er ist nicht dumm, alles andere als das. Er ist nicht triebgesteuert. Und er ist in seinem Tun auch nicht impulsiv, mit der einen Ausnahme am Krankenhaus. Jakob, du weißt nicht mal, ob er auf deinen Trick überhaupt anspringt. Und wenn er darauf anspringt, ob er das so macht, wie du erwartest. Und selbst wenn all das so eintritt, wie du denkst: er ist ein ausgezeichneter Schütze. Dagegen helfen Personenschützer schon mal nicht unbedingt. Und seit dem Mord an Monika Zerres wissen wir auch, dass er ein gewisses Maß an Fantasie hat. Dass er seine Taten sehr präzise plant, wissen wir schon lange.“
Delamotte stand auf. Er wusste genau, er würde Pesch nicht überzeugen. Das hatte er schon gewusst, bevor er sich auf den Weg in dessen Büro gemacht hatte. Pesch umgekehrt schien durchaus zu glauben, seinen Psychologen noch überzeugen zu können. „Immerhin hat die junge Frau diesem Vorgehen zugestimmt“, warf er ein.
Delamotte drehte sich zu Pesch um, er musste sich zusammenreißen, nicht laut zu werden. Stattdessen sprach er ganz leise und artikuliert: „Hat sie das? Na, das ist ja mal ein Ding! Ihr Fahrstil hat dazu geführt, dass eine Kollegin ermordet wurde. So wird sich die ganze Sache für sie darstellen. Sabrina Rosen mag eine flott fahrende und auch ziemlich flott flirtende junge Frau sein. Aber im Moment ist sie voller Schuldgefühle. Jakob – in diesem Gemütszustand würde die junge Frau so ziemlich jedem Vorgehen zustimmen.“ Er verließ das Büro, drehte sich abermals um: „Vielleicht sogar ihrer eigenen Hinrichtung.“
Beim Bäcker erstand Delamotte am nächsten Morgen, neben zwei Croissants und einem Baguette, auch die aktuelle Ausgabe des „Blitz“. Der Aufmacher auf Seite Eins bestand aus einem Foto von Monika Zerres, sicherlich bearbeitet, die Augen wirkten auf Delamotte vergrößert. Offenbar setzte man in der Bildredaktion auf das Kindchen-Schema. Daneben stand, unter dem nur etwas kleiner gedruckten „Kolleginnen fragen: Warum musste Moni sterben?“ die Hauptüberschrift: „Hat der Uhu sie verwechselt?“ Der Text darunter war nur ein kleiner Anreißer, um den Leser zum Kauf und zur weiteren Lektüre im Innenteil der Zeitung anzuregen.
Auf rein professioneller Ebene bewunderte der Psychologe den Boulevardjournalismus. Die Artikel im „Blitz“ waren in aller Regel stark vereinfacht und emotionalisiert. Offenkundige Fehler oder gar Lügen konnte sich die Zeitung, genau wie ihre Konkurrentinnen, allerdings nicht leisten. Der Leser musste zumindest davon ausgehen können, dass am Grundmotiv dessen, was er dort las, etwas dran sein konnte. Die Journalisten mussten in jedem Fall eine Nachfrage bedienen, und sie mussten den Tenor ihrer Berichte im Rahmen dessen halten, was der Kunde lesen wollte. Delamotte erkannte die Diskrepanz, die ganz besonders zwischen dem Boulevard und den öffentlich-rechtlichen Medien bestand. Eine elitäre, missionarische Haltung konnte sich der „Blitz“ gar nicht leisten, ohne die Treue seiner Leserschaft zu riskieren. Seine Mitarbeiter mussten weitaus subtiler vorgehen, wenn sie die Leser von etwas überzeugen wollten.
Zuhause angekommen, bemerkte Delamotte, dass die verschiedenen Artikel die Geschichte der Verwechslung zwischen den beiden Krankenschwestern noch dramatischer darstellten, als sie ohnehin schon war. Zerres habe erst „seit kurzer Zeit“ bei dem Pflegedienst gearbeitet, und sei aufgrund ihrer vorsichtigen Fahrweise beinahe entlassen worden. Einer Fahrweise, die laut guten Freunden ihre Ursache im Unfalltod eines früheren Mitschülers gehabt hatte. Delamotte war beeindruckt; vermutlich war an all dem zumindest etwas dran. Und kombiniert wirkten diese Bestandteile genau so, wie ihre Verfasser es wollten. Nur in einem Punkt ärgerte sich der Psychologe massiv. In einem Artikel über die „verzweifelte Kollegin“, die den Wagen vor Monika Zerres gefahren hatte, wurde zwar nicht der Fahrstil von Sabrina Rosen thematisiert. Dafür aber der Blick vom Balkon ihrer Wohnung, am Rand von Sonnenthal, nur wenige Minuten vom Sitz des Pflegedienstes entfernt. Ein Blick direkt auf den Parkgürtel – warum hatte Pesch der Zeitung nicht gleich die Veröffentlichung der Adresse erlaubt?
Delamotte glaubte jedoch nicht, dass der Uhu den Köder schlucken würde. Es war ihm alles zu einfach gestrickt, zu provokant. Würde dieser eiskalte Killer sich überhaupt von einer Boulevardzeitung beeinflussen lassen? Dass er die Berichte in den Medien verfolgte, schien klar. Die Inszenierung des Mordes an Monika Zerres war Delamotte aber ein Hinweis darauf, dass der Uhu die Öffentlichkeit treiben wollte. Und nicht getrieben werden.
Ein weiteres Exemplar des „Blitz“ landete auf einem Schreibtisch, gut eine halbe Autostunde von Bliesfeld entfernt. Der erste Impuls des Lesers, der die Zeitung abermals weitab von seinem Wohnsitz gekauft hatte, am Zeitungskiosk einer U-Bahn-Station in Wilhelmsberg, war Leugnung gewesen. Lüge! Das konnte alles nur gelogen sein! Die Frau war blond. Und langhaarig. Und mittelgroß. Und auch die Figur hatte gepasst. Und sie fuhr das Auto mit dem gesuchten Kennzeichen.
Aber war das wirklich so? Konnte die Geschichte nicht doch wahr sein? Die meisten Mitarbeiterinnen dieser Firma waren blond. Und sprach wirklich etwas fundamental gegen die Geschichte, die die Zeitung ihm erzählte? Machte es nicht Sinn, neuen Mitarbeitern nicht direkt die neuesten Autos zu überlassen? Und hatte er sich während der Observationsphase nicht manches Mal gewundert, dass diese Raserin auf einmal so behutsam fuhr?
Du bist ein Versager, hatte er sich selbst innerlich angeschrien. Und das war ja auch nicht ungerechtfertigt. Wegen seines Fehlers war vermutlich ein unschuldiges Mädchen getötet worden. Falsch! Er selber hatte ein vermutlich unschuldiges Mädchen getötet. Wie sollte er sich dafür jemals rechtfertigen.
Achtung! Das Ganze ist nur eine Falle! Der nächste Impuls. Und auch für diesen Verdacht sprach so manches. Die Zeitung hatte fast schon aufreizend detailliert beschrieben, wo die junge Dame wohnte, die – angeblich – den Wagen vorher gefahren hatte. Das ließe sich ziemlich leicht eingrenzen, mithilfe von Kartenmaterial und ein paar Spaziergängen in Sonnenthal. Aber vielleicht war das genau die Handlungsweise, in die sie ihn locken wollten. Vielleicht steckte dieser Psychologe dahinter, der zwar jung war, aber nicht so ein naiver Schnösel wie sein Therapeut. Er hatte einiges über diesen Delamotte im Computer gefunden und ja, man musste vorsichtig sein in diesen schwierigen Zeiten.
Sollte die junge Dame doch ihren Blick von Balkon genießen, direkt auf den Parkgürtel. Das tangierte ihn nicht. Wichtiger war die Frage, ob er einen katastrophalen Fehler gemacht hatte. Beileibe nicht den ersten in seinem Leben. Er konnte das zumindest nicht ausschließen. Er musste sich endlich beweisen! Und dafür gab es nur einen einzigen Weg. Er musste die wichtigste Aufgabe seines Lebens erfüllen. Eine Aufgabe, die keinen Fehler erlaubte. Eine Aufgabe allerdings, deren Klarheit die Wahrscheinlichkeit von Fehlern sehr gering hielt. Eine Aufgabe aber auch, die er lange Zeit nicht hatte angehen wollen. Er seufzte. Ein bisschen wehmütig blickte er zu dem alten Karteikasten.
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 24
-
Mehrere Tage gingen ins Land. Ab und an hielt Marino Delamotte auf dem Laufenden. Sabrina Rosen schi…
-
15 Feb 2024
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 22
-
Am Nachmittag saß Delamotte mit Lüttges, Henseler und Pesch in dessen Büro. „Wir wissen also, irgend…
-
08 Feb 2024
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
66 visits
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2025
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
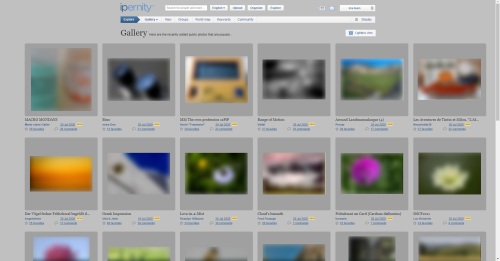
Sign-in to write a comment.