X.
Peschs Anruf erreichte ihn beim Frühstück. „Es gibt hier eine Sache, die könnte dich interessieren – oder eher, die könnte für uns alle interessant werden“, begann der Hauptkommissar.
„Dann schieß los“, drängelte Delamotte.
„Wir haben mal geguckt, ob wir zu dem Namen Ulrich Brückner irgendwas haben – aber da war nichts. Henseler hat dann vorgeschlagen, wir sollten mal nur nach dem Nachnamen suchen“, erklärte Pesch, „wir haben Sachen zu unterschiedlichen Personen namens Brückner gefunden, aber diese eine Geschichte werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen.“ Delamotte wurde langsam ungeduldig. Pesch fuhr fort: „Am 27. Dezember 2002 gab es kurz vor dem Dreieck Sonnenthal einen heftigen Verkehrsunfall.“
„Ich erinnere mich“, unterbrach ihn der Psychologe, „ein LKW fuhr fast ungebremst in ein Stauende, es gab mehrere Tote und Schwerverletzte.“
„Ganz genau“, bestätigte Pesch, „und eine der Toten war eine gewisse Melanie Brückner, wohnhaft in Hannover. Und geboren 1975 in Potsdam.“
„Eine Angehörige?“, fragte Delamotte.
„Das wissen wir noch nicht“, antwortete Pesch, „wir haben eine entsprechende Anfrage gestellt. Dem Geburtsdatum und Geburtsort nach könnte es die Tochter sein.“
Als er gut eine Stunde später die Wohnungstür abschloss, hörte Delamotte aus Brittas Wohnung laute Musik. Er lächelte in sich hinein; die Renovierung seiner alten Wohnung im Mühlenviertel hatte er auch nur mit musikalischer Unterstützung meistern können. Er fuhr mit dem Aufzug in die Tiefgarage, und verstaute mehrere Einkaufstüten und die Kühlbox im Kofferraum des Xsara.
In Baassem fuhr er auf den Ring, dann am Dreieck Berschweiler westwärts. Er dachte ein wenig an den Fall, der Ball lag nun eindeutig bei den Ermittlern. Sie hatten zumindest einen Namen, und Brückner war nun mal im Umfeld von gleich zwei Opfern aufgetaucht, jeweils kurz vor ihrer Ermordung. Das war zumindest schon mal ein Hinweis. Auch das, was sie bislang über die Lebensumstände des Mannes wussten, war zumindest ungewöhnlich. Und sollte die junge Frau, die vor gut anderthalb Jahren auf dem Ring verunglückt war, tatsächlich eine Angehörige von Brückner sein – nun ja, vielleicht hatte Pesch ja recht und das Rätsel des Uhu eine vergleichsweise banale Lösung. Delamotte schaltete das Radio ein, hörte wie der CD-Player rumorte. Wenig später erklang „Learning to fly“ aus den Boxen.
Ein leichter aber beharrlicher Nieselregen begleitete Delamotte auf dem Rückweg, bereits ab dem Moment als er mit einem übervollen Einkaufswagen aus dem riesigen Supermarkt gekommen war. Der Markt, der zu einer französischen Kette gehörte, war größer als Supermärkte in Deutschland, und besser sortiert. Delamotte hatte seine Einkäufe über den nicht minder riesigen Parkplatz transportiert und am Auto auf die Einkaufstüten verteilt, und leicht verderbliche Waren in der Kühlbox verstaut.
Nun rollte der Xsara über die belgisch-deutsche Grenze. Als solche war sie schon seit Jahren nicht mehr erkennbar, Delamotte konnte sich noch an frühere Zeiten erinnern, als junger Bursche war er eigentlich jedes Mal kontrolliert worden. Ob dabei nun Schikane oder Dummheit seitens der Grenzer vorgelegen hatte, oder ob es tatsächlich ihrer Berufserfahrung entsprungen war: er hatte es selten erlebt, dass jemand oberhalb von vielleicht Mitte Dreißig gefilzt worden war, und wenn dann irgendwelche langhaarigen Typen, niemals Krawattenträger.
Zurück in der Cestonarostraße brachte Delamotte erst mal mehrere Sixpacks – Palm, Rodenbach, Jupiler und Stella – in den Kellerraum. Er musste zweimal zwischen Tiefgarage und viertem Stock pendeln, um die restlichen Einkäufe in seine Wohnung zu bringen. Sie auf Regale, Kühlschrank und Tiefkühltruhe zu verteilen, würde eine logistische Herausforderung werden. Gerade als er mit der zweiten Fuhre in die Wohnung gekommen war und begann, die Tüten vom Flur in die Küche zu bringen, hörte er, wie Brittas Wohnungstüre geschlossen wurde. Dann hallten ihre Schritte auf dem Korridor, dem Klang nach trug sie hochhackige Schuhe. Das geht dich nichts an, ermahnte er sich selbst. Britta konnte gehen, wohin sie wollte. Sie musste ihm nicht mal sagen, wohin – und irgendwie war ihm das auch ganz recht.
„Na, du Fuchs, wie bist du denn auf diese Idee gekommen?“ Delamotte blickte zur Tür von Marinos Büro, in dem er wenige Minuten vorher Platz genommen hatte. Sabine Greven stand mit einem breiten Grinsen im Gesicht vor ihm.
„Was für eine Idee?“, fragte er etwas verdattert.
Sabine wedelte mit einem Blatt Papier: „Na, hier diese Liste aus Münster.“ Delamotte blickte sie immer noch fragend an. „Haben sie die etwa nur an Hugo geschickt?“, überlegte die Kriminaltechnikerin und überflog den Ausdruck. „Tatsächlich“, stellte sie fest, „die ist nur an Hugo Alvarez gerichtet. Ich hätte erwartet, dass die Kollegen diese Auflistung auch an dich und Manni schicken würden. Ist ja per Email, kostet doch quasi das gleiche.“
Delamotte blickte auf das Papier, das Sabine vor ihn auf den Tisch gelegt hatte. Es war die Auflistung aller in der Nähe der Autobahntoilette gefundenen Artefakte, um die er Nütting gebeten hatte. „Und was ist da jetzt so besonders, dass du eigens einen Spaziergang zum Berliner Platz unternimmst?“, fragte er lächelnd.
„Na, dann guck mal genauer hin“, antwortete Sabine, „ich geb dir mal nen Tipp: Posten 27.“
Der Psychologe fuhr mit dem Finger bis zur genannten Zeile – mitten unter allerlei Funden wie diversen Zigarettenkippen, Schokoladenpapieren, gebrauchten Papiertaschentüchern – nein, er beneidete die Spurensicherung nicht um diesen Job – und ähnlichem fand sich dort tatsächlich eine sehr interessante Information. Hustenbonbons einer Schweizer Marke, Packungsgröße „Böxli“. Delamotte musste unwillkürlich lachen – hieß diese Packung wirklich „Böxli“?
Sabine bedrängte ihn: „Und jetzt verrate mit bitte, wie du auf diese Idee überhaupt gekommen bist?“
„Ääh“, erwiderte Delamotte etwas überrascht, „also mit diesen Bonbons hatte ich nicht gerechnet. Die gleiche Sorte wie am Tatort in Beyel.“ Sie nickte. „Mein Hintergedanke bei der Bitte an Nütting war eigentlich…“ Er stockte, sprach dann weiter: „Also, es erschien mir ziemlich klar, dass der Uhu nicht geplant hatte, Jensen auf dieser Toilette zu erschießen. Dass er improvisiert hat.“
Sabine wirkte beeindruckt, während Delamotte fortfuhr: „Ich denke auch, aus so einem Grund hat er dieses eingewickelte Bonbon in Beyel verloren. Timing vermasselt oder so was. Er kam zu spät an den Tatort, oder Fischer war schneller da als er erwartet hatte. Vielleicht hat er gedacht, Fischer müsste wirklich tanken, und nicht einfach eine Pizza und zwei Dosen Bier kaufen. Auf jeden Fall zwangen ihn die Umstände dazu, Fischer von der gut ausgeleuchteten Straße aus zu erschießen, statt von dem kleinen dunklen Fußweg, wo ihr dann auch das Bonbon gefunden habt. Die Tatausführung, der Rückzug vom Tatort – das lief dann alles nicht mehr wie geplant, und in dem Ablauf hat er das Ding verloren.“
Er schloss die Augen, rief sich noch einmal die Szenerie auf dem Autobahnparkplatz ins Gedächtnis. „Und im Münsterland war es dann ähnlich“, erläuterte er, „Jensen nutze eine der ersten freien Parktaschen, der Uhu fuhr weiter. Falls dort ein Platz frei war, und offenkundig war das so, parkte er direkt vor dem Toilettengebäude. Er hat vielleicht geahnt, dass Jensen die Toilette aufsuchen würde, viel mehr kann man auf diesen Parkplätzen ja nicht machen. Er hat die Lage gepeilt – und als Jensen am Urinal stand, war die Lage gerade günstig. Keine Zeugen in der Nähe.“
Sabine warf ein: „Aber das heißt doch noch nicht, dass…“
Delamotte unterbrach sie: „Das heißt auf jeden Fall, dass er von seiner üblichen Routine abgewichen ist. Es war noch hell, er musste sehen, dass er Land gewinnt, und die nächste Autobahnausfahrt war fast zehn Kilometer entfernt. Alles Faktoren, die beim Uhu zu Hektik geführt haben können.“
Die Kriminaltechnikerin war noch nicht ganz zufrieden mit der Auskunft: „Aber als du Nütting um diese Liste gebeten hast – womit hast du da gerechnet?“
Delamotte lächelte: „Auf jeden Fall damit, dass er in der Hektik etwas verloren haben könnte. Wie gesagt, Bonbons hatte ich da nicht im Kopf.“
„Sondern“, sagte Sabine mit fragendem Tonfall.
„Also, wenn du wissen willst, worauf ich gehofft habe“, antwortete Delamotte. Sabine nickte kräftig. „Nun – sein Personalausweis, zum Beispiel“, sagte er.
„Jetzt machst du aber Witze“, rief sie aus.
Delamotte grinste: „Überhaupt nicht. Als ich in Amerika war, hatten die Kollegen vom FBI mal so einen Fall. In unmittelbarer Nähe eines Tatorts fand sich ein Portemonnaie, mit allen Papieren, die sie da so haben: Führerschein, Sozialversicherungsausweis, Kreditkarten.“
Die Kriminaltechnikerin blickte ihn mit großen Augen an: „Jetzt sag nicht vom Täter…“
„Doch“, bekräftigte Delamotte, „genau von dem. Der Mann verstaute sein Portemonnaie immer in der Türablage. Und nun, nach einem Mord – vermutlich hat er die Fahrertüre heftiger geöffnet oder geschlossen als sonst. Und das Portemonnaie fiel raus, und in seiner Aufregung hat er es nicht mal bemerkt.“
Sabine lachte auf: „Das gibt’s doch gar nicht!“
„Den Fall hat es gegeben“, sagte Delamotte, „das war irgendwo im Mittleren Westen. Die Handschellen klickten am nächsten Tag.“
„Hallo Liebling, was machst du denn hier?“ Staatsanwalt Thomas Ludes stand vor dem Büro und lächelte Sabine Greven an. Sabine ging zu ihm und begrüßte ihn mit einem Kuss.
„Ich stelle gerade fest“, erklärte sie, „dass Markus ein Genie ist.“
Ludes lachte: „Das stellst du erst jetzt fest? Von Pesch und Neumann höre ich das regelmäßig.“ Er nickte Delamotte freundlich zu: „Manchmal mit dem Zusatz, dass Genies schon mal schwierig sein können.“
„Habe ich da gerade meinen Namen gehört“, klang eine dunkle Stimme über den Gang. Pesch erschien in der Tür, sein Outfit wirkte heute besonders altbacken, dachte Delamotte. „Thomas, grüß dich, sorry für die kurzfristige Einladung“, sprach er Ludes an. Dann bemerkte er, dass die Lebensgefährtin des Staatsanwalts ebenfalls anwesend war: „Hallo Sabine.“ Er blickte in Delamottes Richtung: „Markus, kommst du bitte auch mit? Ich hätte dich jetzt gerne mit dabei.“
Manni Lüttges gesellte sich dazu, sie saßen in Peschs Büro. Der Hauptkommissar fasste den Stand der Dinge zusammen: „Was haben wir bis jetzt? Dieser Brückner war auf jeden Fall im oder zumindest am Stadion von Borussia Marßen, als Sötenich auch dort war. Zwei Tage vor dessen Ermordung. Er war auch zumindest in der Nähe der Oper, als Dorn und seine Partnerin eine Aufführung von „Fidelio“ besuchten – in diesem Fall vier Tage, bevor Dorn ermordet wurde. Weder die Lebensgefährtin von Sötenich noch die von Dorn können mit diesem Brückner was anfangen.“
Ludes wirkte skeptisch: „Es gibt manchmal ziemliche Zufälle, Jakob.“ Das musste er Pesch nicht extra erklären, dachte Delamotte, Jakob hatte schon genug irre Zufälle gesehen.
„Gemeldet ist Brückner in Brandenburg, irgendwo südlich von Berlin. Da wohnt er aber seit ein paar Jahren nicht mehr. Angeblich ist er ins Ausland gezogen, macht aber jedes Jahr brav seine Steuererklärung. Die Post lässt er sich von der Hausbesitzerin postlagernd nach Aachen schicken“, fuhr Pesch fort. Ludes hörte konzentriert zu.
„Was ein denkbares Motiv angeht, verfolgen wir gerade noch einen Hinweis“, erläuterte Pesch, „bei diesem Horrorunfall kurz nach Weihnachten 2002 ist nämlich eine Melanie Brückner ums Leben gekommen – geboren in Potsdam, dem Alter nach könnte sie seine Tochter sein. Die Antwort auf unsere Anfrage steht noch aus.“ Er holte kurz Luft, bevor er noch einen Punkt loswurde: „Und wie wir eben erst erfahren haben: einen Tag vor dem Mord an diesem Jensen im Münsterland geriet Brückner in eine Verkehrskontrolle – er kassierte ein Verwarngeld, weil sein Verbandskasten nicht in Ordnung war. Und das im Emsland, also nicht allzu weit vom Münsterland entfernt.“ Aller Augen richteten sich nun auf den Staatsanwalt.
„Also: einen Haftbefehl bekommst du auf dieser Grundlage nicht durch, Jakob“, sagte er, „dafür sind die Hinweise zu vage. Aber was ich für euch tun kann: Zugriff auf seine Kontodaten bekommen. Immerhin, er kann zumindest ansatzweise mit drei Mordfällen in Verbindung gebracht werden, hätte möglicherweise ein wenn auch verqueres Motiv, aber was besonders wichtig ist: sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Da können die Kontodaten für Aufklärung sorgen, zum Beispiel wo er Geld abhebt und so weiter.“
Pesch nickte dankbar: „Danke Thomas, wenn wir diese Daten bekämen, wäre uns schon sehr geholfen.“
Lüttges meldete sich zu Wort: „Bei den Schützenvereinen, deren Daten wir bis jetzt haben, taucht Brückner übrigens nicht auf. Aber ich bin schon überrascht, wie viele verdammt gute Schützen es in dieser Stadt gibt. Und damit meine ich nicht, besser als Claudio. Verdammt gut heißt: besser als wir beiden, zum Beispiel.“ Dabei blickte er Pesch an, der ungläubig wirkte.
Der Saint-Émilion Grand Cru funkelte rubinrot im Glas. In Delamottes Mund knirschte ein Bissen geröstete Brioche, mit Foie Gras belegt. Ein Sauternes wäre als Begleiter zu naheliegend gewesen, die Kombination mit dem kraftvollen Rotwein sagte ihm mehr zu. Er probierte von den Aprikosen, die er mit einer halben Habaneroschote angebraten und mit einem Schluck Armagnac abgelöscht hatte. Süße und Schärfe harmonierten perfekt.
Später saß er im Arbeitszimmer, vor sich das Weinglas. Sabine Greven hatte ihm die Liste der Funde vom Autobahnparkplatz weitergeleitet, versehen mit der Bemerkung, dass die Kollegen in Münster das „Böxli“ auf Fingerabrücke untersuchen würden. Hinter das Wort „Böxli“ hatte sie ein Smiley gesetzt. Delamotte war sich sicher, dass die Kollegen Fingerabdrücke finden würden.
Er öffnete das Fenster, mit der frischen Luft kamen auch die Geräusche eines etwas zu kühlen, aber immerhin trockenen Sommerabends hinein. Die Kulisse von startenden Motoren, Fahrradklingeln, Gesprächen, Reifen auf Asphalt, Musik aus Autolautsprechern und dem Bimmeln von Handys machte Delamotte klar, wie leise der Abend bis zu diesem Punkt verlaufen war. Seit ihren samstäglichen Schritten auf dem Weg zum Aufzug hatte er Britta weder gehört noch gesehen.
Er schaltete das Radio aus – genug gehört hatte er bereits, und letztlich kolportierte Radio Marßen nur die Gerüchte, über die der „Blitz“ schon in epischer Breite berichtet hatte. Angeblich verfolgte die Polizei gerade eine heiße Spur – ein Verdächtiger sei im Umfeld mehrerer Opfer aufgetaucht. Er hatte eine ganze Zeit lang darüber nachgedacht. Beim „Blitz“ konnte man nie wissen, die meisten Artikel – selbst dieser Begriff war nicht ganz passend – basierten auf Spekulation, Hörensagen, Wunschdenken. Andererseits schien das Boulevardblatt manchmal tatsächlich interne Quellen in Behörden zu haben. Und letztlich konnte er auch die Möglichkeit nicht ausschließen, dass die Polizei selber solche Gerüchte in die Welt setzte, vielleicht um den Druck der Öffentlichkeit etwas zu lockern.
Aber nach einiger Zeit hatte er sich wieder beruhigt. Dass er direkt bei der Ausübung seiner Tätigkeit – seiner gesellschaftlich nützlichen Tätigkeit, das doch bitte nicht vergessen – beobachtet worden war, schloss er aus. Höchstens bei dem Versicherungsvertreter, da waren einige Dinge durcheinander gegangen, doch wenn ihn dort jemand gesehen hätte, wäre das doch schon längst veröffentlicht worden. Fahndungsaufrufe, eine Beschreibung, egal wie gut.
Natürlich war da noch die Beobachtung der Zielpersonen gewesen. Er wusste nicht, wie viel Aufmerksamkeit die Polizei diesem Aspekt schenkte. Während der Observationsphase ließ es sich nicht vermeiden, den Zielpersonen auch während des Tages nahezukommen. Aber er war immer sehr vorsichtig vorgegangen – außer bei der Kosmetikerin, da hatte er sogar am Nebentisch gesessen, mit pochendem Herzen. Allerdings waren die Frau und ihre beiden Freundinnen so sehr in ihr Gespräch vertieft gewesen, dass sie wohl kaum etwas Aufmerksamkeit für den Mann gehabt hatten, der gerade mal zwei Meter von ihnen entfernt gesessen hatte. Völlig undenkbar.
Also kam er zu dem Schluss, dass die Berichte doch eher in die Kategorien Hörensagen oder Wunschdenken gehörten. Er würde ein paar Tage entspannen. Ein weiteres Gespräch mit seinem Therapeuten stand an, fast schon freute er sich darauf. Danach würde er sich, geistig frisch gestärkt, wieder einmal seinem Karteikasten widmen.
Marino und Lüttges machten sich auf den Weg nach Aachen. Mit einem örtlichen Kollegen fuhren sie zum Hauptpostamt der Stadt. Überraschenderweise konnte sich eine der zuständigen Beamtinnen sogar an Brückner erinnern – er hatte, ihrem Gedächtnis zufolge, in den zwei Jahren, die sie nun in dieser Abteilung arbeitete, etwa fünfmal seine Post bei ihr abgeholt.
Noch überraschter waren die Ermittler, als sie der Dame das Passfoto Brückners zeigten. „Das ist doch nicht Herr Brückner“, sagte die Mitarbeiterin fast schon entrüstet. Der Herr Brückner, der seine Post bei ihr abgeholt hatte – und dieser Umstand ließ sich anhand der Unterlagen nachvollziehen – war nicht grauhaarig gewesen. „Er hat sattes, schwarzes Haar“, erklärte die Beamtin und fügte hinzu: „Und er sieht generell deutlich jünger aus als dieser Mann auf dem Foto, und er hat auch keine Brille.“ Sie überlegte eine Weile und wies dann noch mal auf das Bild: „Der da, der sieht ja fast aus wie der Honecker.“ Marino hätte beinahe laut gelacht – aber auf der Rückfahrt nach Marßen rätselten er und Lüttges, was das nun wieder in Bezug auf den früheren Stasimitarbeiter Brückner bedeutete.
Als die beidem im dritten Stock des Polizeipräsidiums ankamen, hörten sie schon von Weitem Pesch toben: „Das darf doch nicht wahr sein!“
Ludes hatte ihn gerade angerufen. Der verantwortliche Richter in Brandenburg hatte den Eilantrag der Marßener Staatsanwaltschaft betreffend der Kontodaten erst einmal abgelehnt. Es waren ihm zu viele Unwägbarkeiten, und überhaupt. „Was werfen sie dem Mann denn überhaupt vor“, hatte er Ludes am Telefon gefragt, „dass er ein Fußballspiel besucht? Oder die Oper? Oder dass sein Verbandskasten nicht ganz in Ordnung ist?“
Nein, da brauchte der Richter schon ein bisschen mehr und die Marßener Behörden sollten ihm doch mal bitte eine umfangreiche Zusammenfassung des ganzen Komplexes zukommen lassen nebst einer Einlassung darüber, wie sie denn überhaupt auf den Herrn Brückner aus Storkow kämen, der ja bislang ein unbeschriebenes Blatt sei.
Sie saßen auf der Terrasse. Zum ersten Mal seit mindestens zwei Wochen konnte man abends draußen sitzen, ohne nass zu werden oder zumindest ein bisschen zu frösteln. Tatjana räumte den Tisch ab, ihr Pilaw hatte großartig geschmeckt. Als Vorspeise hatte es Blinis mit Kaviar und saurer Sahne gegeben, und Delamotte war sich im Klaren darüber, dass gleich garantiert noch ein Stück Kuchen folgen würde.
Holger öffnete den moldawischen Wein, den Delamotte mitgebracht hatte. „Schön, mal wieder bei Euch zu sein“, sagte der Psychologe.
„Du weißt doch, du bist uns jederzeit willkommen“, antwortete der Gastgeber. Holger war schon zu Schulzeiten ein enger Vertrauter gewesen – einer der ganz wenigen, die von Delamottes damaliger Affäre mit Ellen Abramczyk wussten.
Nach der Schule hatte er in München Elektrotechnik studiert. Eigentlich hatte er in Süddeutschland bleiben wollen, aber dann war er bei einem Heimatbesuch auf Tatjana aufmerksam geworden, und hatte sich in Windeseile in sie verliebt. Sie hatte seine Gefühle durchaus erwidert – aber ihre Familie war nun mal im Rahmen ihrer Spätaussiedlung aus Kasachstan wenige Jahre zuvor nicht in den Süden, sondern in den Westen Deutschlands gezogen. Und ihre Familie, das hatte sie Holger sofort beigebracht, war ihr sehr wichtig. Und Tatjanas Familie, das hatte Holger dann auch rasch begriffen, war sehr groß.
Also war Holger nach Marßen zurückgekehrt, und hatte rasch eine gute Stelle bei einem regionalen Energieversorger gefunden. Wenig später hatte er Tatjana vor den Traualtar geführt, und schon bald war aus den Eheleuten Baltes die Familie Baltes geworden.
Zwischen den beiden Kindern war dann noch das Haus in Kessenich dazugekommen. Kessenich war früher einmal ein kleines Dorf westlich von Bliesfeld gewesen – Delamotte erinnerte sich noch an Radtouren mit Holger, Mischa und anderen Jungs, über die Felder nach Kessenich und dann den Gallberg hoch zum Strandbad am Apostelsee. Die Felder, die sie damals durchquert hatten, waren überwiegend Neubausiedlungen gewichen. Eines der übrig gebliebenen Stücke Land hatten Holger und Tatjana günstig erworben – es hatte geholfen, dass Mischa Stockert nach der Schule zur Sparkasse gegangen war. Noch hilfreicher war natürlich der Umstand gewesen, dass Tatjanas Familie, wie bereits erwähnt, sehr groß war. Und im Gegensatz zu den meisten Alteingesessenen wussten die Aussiedler auch sehr genau, welches Werkzeug für welchen Arbeitsschritt benutzt wurde, und in welcher Form.
Tatjana kehrte auf die Terrasse zurück: „Essen wir den Kuchen direkt, oder wollt ihr noch etwas warten?“
„Lass uns noch etwas Zeit, Liebling“, sagte Holger und goss seiner Frau ein Glas Wein ein. „Probier den mal, der ist klasse.“
Sie setzte sich und legte ihre Hand auf Delamottes Unterarm: „Markus, hast du dich denn schon eingelebt? Kennst du wenigstens schon die Nachbarn?“
Delamotte lachte: „Es ist ein ziemlich großes Haus, Tatjana.“
„Na, dann kannst du ja viele Leute kennenlernen“, erwiderte sie.
Er schüttelte den Kopf: „Wirklich kennengelernt habe ich nur zwei Mietparteien. Einmal Nicky und Theo, ein Pärchen mit griechischen Wurzeln, die beiden kenne ich erst seit kurzem. Und dann natürlich Britta, meine direkte Nachbarin zur Linken.“
Tatjana grinste: „Warum natürlich? Sie ist also nett, hmm?“
Delamotte seufzte: „Tatjana, bitte… Ja, sie ist nett, aber…“
„Kein aber hier“, unterbrach sie ihn, „nette Frauen sind Gold wert.“ So ähnlich hatte sich Claudio auch schon mal geäußert, dachte Delamotte. „Und außerdem“, fuhr Tatjana fort, „wird es bei dir doch so langsam mal Zeit. Und die meisten meiner Freundinnen sind inzwischen in festen Händen.“
„Was ist denn mit Larissa? Die ist doch wieder solo“, warf Holger ein.
Tatjana schüttelte energisch den Kopf: „Nicht doch Larissa, die wäre für Markus viel zu hart.“
„Wahrscheinlich willst du sagen, ich bin zu weich für die Dame“, sagte Delamotte.
„Du bist nicht zu weich, mein Lieber“, antwortete sie, „du bist sehr sensibel, aber das ist nichts Schlimmes. Aber was Larissa angeht: die ist zu hart, und deshalb laufen alle Jungs nach ein paar Wochen vor ihr weg.“ Sie stand auf, um Kaffee und Kuchen zu holen. In der Terrassentür drehte sie sich nochmal um: „Mila wäre die Richtige für dich gewesen. Oder auch Alyssa – aber die hat letzten Monat geheiratet, endlich.“
Erst gegen zwei Uhr in der Nacht kehrte Delamotte per Taxi in die Cestonarostraße zurück. Es hatte ihm sehr gut getan, mal wieder unbeschwert mit alten Freunden zu plaudern. Ein wenig fühlte es sich aber auch an wie vor ein paar Monaten, kurz nach der Trennung. Der Gedanke missfiel Delamotte, aber er verfolgte ihn noch bis in seine Träume.
Das Büro, das Maas und Henseler zu einer Art Heimkino umgebaut hatten, war derart überfüllt, dass der Beauftragte für Arbeitssicherheit sofort eingeschritten wäre. Pesch hatte die Idee gehabt, den großen Monitor zu nutzen, um einige neue Erkenntnisse zur Ermittlung mit dem Team zu teilen. Ludes war kurzfristig dazu gestoßen, ebenso Stegmayer und sogar Neumann, der sich neben Delamotte gestellt hatte. Wenn es um Brückner ging, dachte der Psychologe, war der Raum trotzdem passend, schließlich waren sie hier auf ihn aufmerksam geworden.
„Es gibt Neuigkeiten zu Ulrich Brückner, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Ich fange mal mit der am wenigsten spektakulären an“, begann Pesch und gab Henseler ein Zeichen. Auf dem Monitor erschien eine Akte, vermutlich gescannt, von nicht gerade überragender Qualität, aber lesbar. Pesch ersparte den Zuschauern diese Mühe und erklärte: „Die letzte Hauptuntersuchung von Brückners Auto war Anfang diesen Jahres. Eigentlich war er schon zwei Monate überfällig. Durchgeführt wurde die Untersuchung in einer Werkstatt in Rott – Autohaus Junckers.“
„Das beweist schon mal, dass er sich regelmäßig hier aufhält“, sagte Stegmayer.
„Mehr als das“, bekräftigte Pesch, „wir haben mit Junckers gesprochen – seit Frühjahr 2002 war Brückner öfters dort. Kleinere Reparaturen, Reifenwechsel – sein Lebensmittelpunkt scheint spätestens seit 2002 hier in der Region zu sein.“
Abermals nickte der Hauptkommissar Henseler zu. Delamotte blickte in das ernst blickende Gesicht eine brünetten Frau Mitte Zwanzig, es sah nach einem Ausweisfoto aus.
„Melanie Brückner, eines der Opfer des Horrorunfalls von Schwabstadt, Ende 2002. Sie ist tatsächlich Ulrich Brückners Tochter. Vor ihrer Abfahrt aus Hannover hatte sie damals einer Freundin mitgeteilt, sie würde zwischen den Feiertagen ihren Vater treffen – zum ersten Mal seit fast zwei Jahren“, erzählte Pesch.
„Ist Brückner verheiratet?“, fragte Neumann interessehalber.
„Er war es“, antwortete Pesch, „die Ehe ist Anfang der Neunziger Jahre geschieden worden. Seine Exfrau, Lieselotte Brückner, zog danach mit der gemeinsamen Tochter in den Westen, nach Kiel. Die Tochter machte nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung und zog Mitte 1999 nach Hannover.“
„Interessant in dieser ganzen Familiengeschichte ist noch etwas“, erwähnte Lüttges gewohnt ruhig. „Für den Tod seiner Tochter scheint sich Brückner kaum interessiert zu haben – zumindest nicht öffentlich. Um die Beerdigung hat sich die Mutter der jungen Frau gekümmert – Ulrich Brückner ist bei der Trauerfeier gar nicht aufgetaucht. Wir haben auch keinerlei Traueranzeige von ihm gefunden. Seine Exfrau hat ihn seit der Scheidung nicht mehr gesehen – sie war überrascht, dass die gemeinsame Tochter Kontakt zu ihrem Vater hatte.“ Delamotte horchte auf; dieser Umstand war wirklich ungewöhnlich.
„Was hat Brückner eigentlich in den Jahren nach der Wende so getrieben?“, wollte Stegmayer wissen. „Er wird ja mit seiner Stasi-Vergangenheit wohl kaum Personenschützer geblieben sein, oder?“
„Ja und nein“, erwiderte Pesch, „mehr als zwei Jahre lang war er Fahrer und Bodyguard eines Geschäftsmannes, der in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und im Osten Berlins so einen angeblich unabhängigen Versicherungsvertrieb aufgezogen hatte, ziemlich erfolgreich offensichtlich. Bis der Mann dann von einem Journalisten als ehemaliger Stasiagent enttarnt wurde.“
„Lebt der Journalist noch“, warf Delamotte ein.
Pesch schien überrascht: „Wie kommst du darauf?“ Er holte Luft: „Nein, der Journalist lebt nicht mehr. Gut ein Jahr nach dem Skandal kollidierte sein Auto auf einer dieser alten Alleestraßen im Osten mit einem Baum.“
„Tja, alte Seilschaften“, murmelte Neumann.
Pesch fuhr fort: „Ungefähr zu der Zeit, als dieser Versicherungsmanager aufflog, ist dann wohl auch Brückners Ehe gescheitert. Danach war er gut anderthalb Jahre lang Sicherheitsbeauftragter einer Druckerei, die früher mal der SED gehört hatte. Dann noch fast drei Jahre Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei in Potsdam, mit angeschlossener Detektei. Und bevor ihr fragt: ja, auch der Chef dieser Kanzlei wurde immer wieder mal mit der Stasi in Verbindung gebracht, aber bewiesen wurde das nie.“
Ludes grinste: „Wenn es die Kanzlei ist, an die ich gerade denke, ist es auch ratsam, den Stasi-Verdacht nicht öffentlich zu erwähnen. Der besagte Herr ist sehr klagefreudig.“ Delamotte gefiel, dass Ludes nicht vom „besagten Kollegen“ gesprochen hatte.
„Tja, und 1998 hat Brückner sich dann selbständig gemacht“, schloss Pesch die Vita des Mannes ab.
„Als technischer Dienstleister“, kommentierte Marino ironisch.
„Irgendwie kommt mir bei der ganzen Sache ziemlich oft die Stasi vor“, sagte Stegmayer.
„Dann warte mal ab, das Beste kommt noch“, kündigte Pesch an. Das Bild, das nun erschien, sorgte für Raunen. Zu sehen war ein jüngerer Mann, der in einem Büro von einem älteren Mann eine Urkunde überreicht bekam. Beide Männer trugen Uniform.
„Ist das nicht dieser Mielke“, rief Jutta Maas aus.
„Und der junge Kerl ist Brückner?“, fragte Stegmayer. Pesch nickte.
Neumann stupste Delamotte an: „Einmal Tschekist, immer Tschekist.“ Der Psychologe nickte grinsend.
Als sich die Unruhe wieder gelegt hatte, bestätigte Pesch: „Ja, ihr habt richtig gesehen. Der Genosse Brückner erhält vom Genossen General Mielke eine Auszeichnung – ich glaube zumindest, der Halunke hatte einen Generalsrang. Und Brückner war damals, 1981, bester Pistolenschütze im Ministerium für Staatssicherheit.“
Marino ließ einen Pfiff hören. „Welche Personen hat der Kerl denn eigentlich beschützt?“, fragte Stegmayer. „Honecker etwa?“
„Das wissen wir nicht genau“, antwortete Lüttges, „aber es wäre denkbar. Seit 1983 war sein Dienstsitz in Wandlitz.“
„Da hat er übrigens auch seinen späteren Arbeitgeber getroffen“, ergänzte Pesch, „der war dort für die Versorgung der hohen Herrschaften verantwortlich.“
Als die Gruppe das Büro verließ, sagte Ludes: „Die Punkte sind auf jeden Fall starke zusätzliche Argumente gegenüber diesem Richter in Brandenburg.“
„Ich hoffe, da hast du recht“, bemerkte Neumann. Delamotte verstand die Andeutung, und er selber hatte ähnliche Bedenken.
Er spürte eine Berührung am Oberarm. „Hast du noch einen Moment?“, fragte Henseler. „Ich habe dir da was vorbereitet.“ Delamotte folgte dem jungen Kommissar in das Büro, das Lüttges früher mit Marquardt geteilt hatte. Offenbar hatte Henseler dessen Platz nun übernommen. Er drückte Delamotte eine eng bedruckte Seite in die Hand und erklärte: „Das ist eine Auswertung aus den Daten, die wir von den Schützenvereinen und Schießständen bekommen haben. Mitglieder zwischen Ende Vierzig und Mitte Fünfzig, also ungefähr in dem Alter, das der Uhu hat. Und allesamt sehr gute Schützen, mit herausragenden Leistungen auf dem Schießstand.“ Delamotte bedankte sich.
„Im Moment sieht ja alles sehr stark nach diesem Brückner aus“, sagte der Psychologe vorsichtig.
Henseler lächelte: „Denkst du das wirklich?“
Delamotte schüttelte leicht den Kopf: „Absolut überzeugt bin ich nicht.“
„Ich auch nicht“, bestätigte der Kommissar.
„Es gibt da ein paar Sachen, die nicht ganz passen, die Beobachtung Sötenichs vor vielen Jahren zum Beispiel. Da war Brückner noch im Osten. Gut, man könnte jetzt sagen, es gibt keinen Beweis, dass der Typ, den Sötenichs Frau damals gesehen hat, überhaupt der Uhu war“, merkte Delamotte an. „Und dann ist da natürlich diese eine Merkwürdigkeit von vorhin“, fuhr er fort, „dass jemand durch den Tod einer geliebten Person zum Mörder wird, ist keine Seltenheit. Aber Brückner war nicht mal bei der Beerdigung seiner Tochter.“
Henseler hatte noch einen weiteren Punkt: „Ich bin sicher: was immer dieser Brückner hier so treibt, koscher ist es nicht. Umso mehr wundert mich aber, dass er nach dem Tod seiner Tochter so ausrastet. Völlig out of control. Dabei denke ich natürlich besonders an die Sache mit dem Arzt.“ Er blickte Delamotte fest an: „Sollte einer, der mal bei der Stasi war, sich nicht besser im Griff haben?“
Der Einwand war absolut berechtigt, fand Delamotte. Er fragte: „Und warum gehst du davon aus, dass Brückner in irgendwelche krummen Sachen verwickelt ist?“ Der Psychologe hatte durchaus bereits ähnliche Mutmaßungen angestellt, aber irgendwie hatte er das Gefühl, dass Henseler ein paar weitere interessante Gedanken mit sich trug.
„Setz dich, ich zeig dir mal was“, sagte der junge Kommissar. Auf dem Monitor seines Rechners war eine bekannte Suchmaschine zu sehen. Henseler tippte „Markus Delamotte“ ein – in den Suchergebnissen tauchten Zeitungsartikel über einige Ermittlungen auf, an denen Delamotte beteiligt gewesen war, aber auch noch ganz andere Dinge.
„Bis heute wusste ich noch gar nicht“, stellte Henseler fest, „dass du Ehrenmitglied in einem Eishockey-Fanclub bist.“
„Ehrensenior“, korrigierte Delamotte.
„Aber du siehst, über dich ist ganz schön viel zu finden“, sagte Henseler. Delamotte verstand – und diese Erkenntnis gefiel ihm nicht wirklich.
Niclas Henseler schien seinen Gedanken zu lesen: „Mach dir nichts draus, das geht auch anderen so.“ Er suchte nach seinem eigenen Namen – und Delamotte erfuhr, dass Henseler Schlagzeuger in einer Band war, oder zumindest gewesen war, und gerne kletterte.
Unter den Ergebnissen der nächsten Suche befand sich ein Zeitungsartikel über die Geburtstagsfeier von Giacomo Marino, Vorsitzender eines italienischen Kulturvereins in Koblenz. Delamotte bat Henseler, das Foto zu vergrößern; Claudio stand hinter seinem Vater, die Hände auf dessen Schultern gelegt. Neben ihm stand eine atemberaubend schöne junge Frau. Henseler grinste: „Tja, Claudios Schwester ist schon ein Hingucker, was? Leider ist die Schöne schon vergeben.“ Er wies auf einen Absatz in dem Artikel hin; Giacomo Marinos Tochter Lucrezia Salvi war mit dem Betreiber eines exquisiten italienischen Restaurants in Bingen verheiratet.
Henseler hatte noch zwei weitere Beispiele. Hans-Jakob Pesch, lernte Delamotte, war Vorstandsmitglied im Motorsportverein der Polizei.
Das letzte Suchergebnis ließ den Psychologen zunächst an seinen Sinnen zweifeln, oder auch an seinem Verstand. Das Foto, das Henseler diesmal vergrößerte, zeigte einen großen, schlaksigen Mann, in hohen schwarzen Stiefel, einer weißen Gardehose, einer grünen Uniformjacke sowie einem Dreispitz mit Pelzrand. Er stemmte eine zierlich Frau in die Höhe, die ebenfalls Dreispitz und Uniformjacke, allerdings weiße Stiefel und ein weißes Röckchen trug. „Nein“, rief Delamotte, „komm, gib zu, das ist jetzt eine Fälschung!“
Henseler lachte, schüttelte aber den Kopf: „Nein nein, das Bild ist echt. Schon ein paar Jahre alt, aber echt. Ja, der gute Manni war mal Tanzoffizier bei der Hafengarde. Er war übrigens selber schockiert, dass man das so leicht rausfinden kann.“
Delamotte war amüsiert, fragte aber: „So spaßig das ist, aber: wo ist der Zusammenhang mit Brückner?“
Henseler erklärte: „Such einfach mal nach Ulrich Brückner. Oh, du findest eine Menge Brückners im ganzen Land, auch den einen oder anderen Ulrich. Aber keinen mit Geburtsjahr 1952, keinen mit Wohnsitz in Storkow, keinen der auch nur entfernt dem Foto ähnelt, das wir von dem Kerl haben.“
Beeindruckt warf Delamotte ein: „Das heißt, im Internet existiert er nicht.“
„Keine einzige digitale Spur“, bestätigte Henseler, „kommt dir das nicht auch verdächtig vor?“
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 18
-
Es war bereits dunkel, als der Xsara in die Tiefgarage rollte. Delamotte hatte das Polizeipräsidium…
-
30 Jan 2024
Der Ring - Fortsetzungsroman, Teil 16
-
Im Laufe des Nachmittags wurde Delamotte klar, dass sie die ganze Zeit über Zeugnisse aus den letzte…
-
28 Jan 2024
See all articles...
Authorizations, license
-
Visible by: Everyone (public). -
All rights reserved
-
52 visits
Jump to top
RSS feed- Latest comments - Subscribe to the feed of comments related to this post
- ipernity © 2007-2024
- Help & Contact
|
Club news
|
About ipernity
|
History |
ipernity Club & Prices |
Guide of good conduct
Donate | Group guidelines | Privacy policy | Terms of use | Statutes | In memoria -
Facebook
Twitter
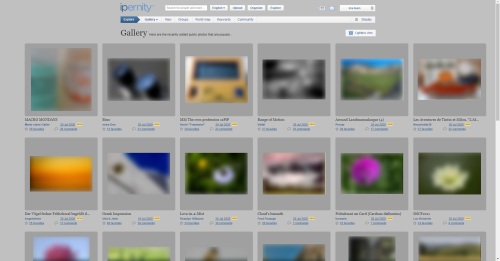
Sign-in to write a comment.